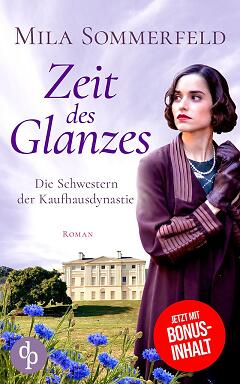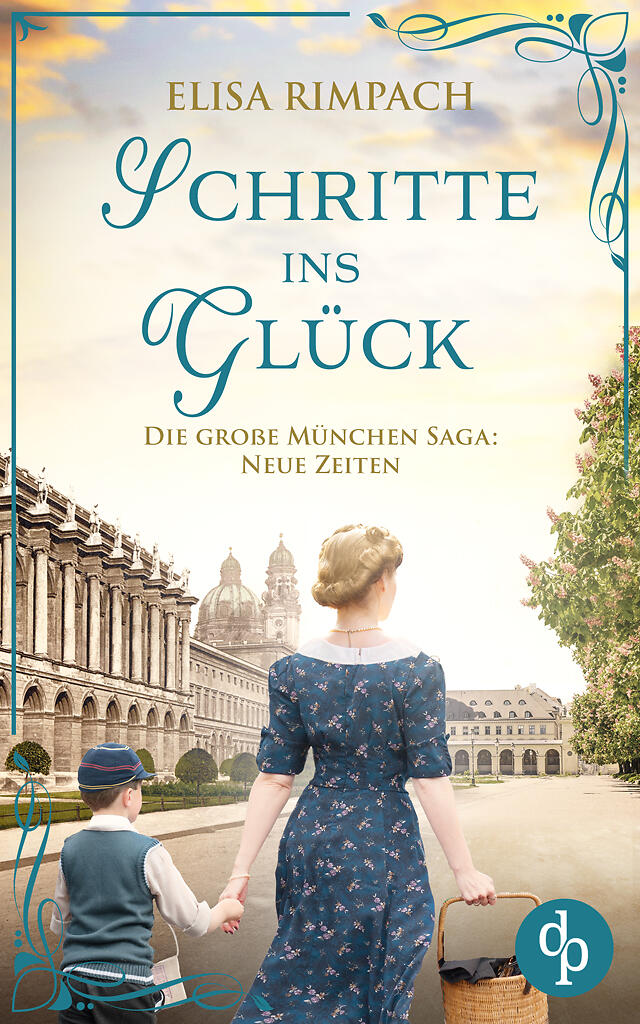Kapitel 1
Weimar und München, Karsamstag, 31. März 1923
„Dadenhaus.“
Paulchen zeigte mit dem kleinen Finger auf das zweistöckige Gebäude am Fuß des Horns auf der gegenüberliegenden Seite des Ilmparks.
Hilde schmunzelte. „Sehr schön, wie gut du dich daran erinnerst. Und wem hat das Haus früher gehört?“
„Döde“
„Ausgezeichnet, ja, das ist Goethes Gartenhaus.“
Sie tauschte einen Blick mit Tante Isolde, die ihr zulächelte.
„Du hast ein sehr schlaues Kind“, sagte sie. „Aber bei der Mutter hatte ich mir nichts anderes erwartet.“
Hilde schluckte. Sie sah ihren Sohn an: das ernste, ein wenig bleiche Gesicht, die braune Haarlocke auf seiner Stirn, die so gut zu seinen Augen passte. Er war das Ebenbild seines Vaters. Und der war ebenfalls ein kluger Kopf gewesen.
„Wie gefällt es euch in Weimar?“, fragte Isolde.
„Doll“, sagte Paulchen. Hilde und ihre Tante wechselten einen Blick und brachen dann in ein herzliches Lachen aus.
„Du hast ihn gehört. Er mag es hier. Und auch ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, München den Rücken zu kehren. Zumindest für eine gewisse Zeit.“
„Wie läuft es an der Hochschule?“, fragte Isolde.
„Das kann ich noch nicht so recht beurteilen. Momentan belege ich den Vorkurs. Er dient dazu, die Schüler an die künstlerischen Techniken und den Grundgedanken des Bauhauses heranzuführen. Aber bald steht die Wahl einer Werkstatt an.“
„Die Wahl einer Werkstatt? Das klingt aber nicht nach studieren, oder?“
Hilde lachte. „Nein, das ist hier keine klassische Universität oder Kunstakademie. Das Bauhaus ist dem Gedanken verpflichtet, dass alle Künste zusammen an einem gemeinsamen Werk arbeiten. So wie früher im Mittelalter in den Dombauhütten. Die praktische Tätigkeit und das Ergebnis stehen im Vordergrund. Aber natürlich ist die Beschäftigung mit den Grundlagen der Kunst eine wichtige Voraussetzung dafür. Professor Itten, der den Vorkurs leitet, hat beispielsweise eine eigene Farbenlehre entwickelt.“
Isolde hob die Hand. „Du musst einer alten, naturwissenschaftlich ausgebildeten Medizinerin nachsehen, wenn sie über dieses Lehrkonzept zum einen überrascht, zum anderen aber auch sehr erfreut ist. Das klingt großartig. Alle arbeiten zusammen an einem Werk. Wenn ich mir die Welt so anschaue, ist das eher die Ausnahme als die Regel.“
Hilde seufzte. „Ja, da hast du sicher recht. Ich hatte so sehr gehofft, dass Deutschland und dass wir alle nach der gescheiterten Revolution zur Ruhe kommen würden. Aber ich habe das Gefühl, dass es immer nur noch schlimmer wird. Alles bricht auseinander. Die Franzosen haben das Rheinland besetzt, weil sie die Regierung dazu zwingen wollen, die Kriegsentschädigungen zu bezahlen. Die Bevölkerung dort leistet passiven Widerstand und streikt. Aber ich befürchte, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es zu Kämpfen kommen wird, bis Menschen sterben, so wie damals bei uns in München. Und gleichzeitig schlittert die Wirtschaft immer tiefer in die Krise und die Mark verliert Tag für Tag an Kaufkraft. Heute Morgen habe ich 400 Mark für einen Laib Brot bezahlt. 400 Mark! Das ist doch Wahnsinn!“
„Ja, das ist es. Kommst du zurecht?“, fragte Isolde.
Hilde nickte. „Mama ist sehr großzügig. Die Beträge, die sie mir wöchentlich auf mein Konto überweist, passt sie schon im Voraus an die zu erwartende Teuerungsrate an. Ich kann nicht klagen. Im Vergleich zu vielen meiner Mitstudentinnen könnte ich in Saus und Braus leben. Auch wenn der größte Luxus, den ich mir gönne, die Gouvernante für Paulchen ist.“
Hilde wandte den Kopf und lächelte Frau Gerwig zu, einer hochgewachsenen, hageren Frau in einem schlichten, grauen Leinenkleid. Diese antwortete mit einem Nicken.
„Ich finde es bewundernswert, wie du beides unter einen Hut bringst. Paulchen und das Studium“, sagte Isolde.
Hilde schüttelte den Kopf. „Das ist nicht bewundernswert. Ich bin nicht die einzige Studentin mit einem kleinen Kind. Aber keine meiner Kommilitoninnen hat eine Gouvernante, die sich tagsüber um das Kind kümmert. Diese Mütter leisten Übermenschliches, ich nicht. Ich weiß, dass Paulchen gut versorgt ist, und trotzdem habe ich oft ein schlechtes Gewissen, dass ich an das Bauhaus gehe, anstatt mich um meinen Sohn zu kümmern.“
„Das ist wohl das Dilemma jeder berufstätigen Frau mit Kindern. Für mich war das ja nie ein Thema“, sagte Tante Isolde.
Hilde warf ihr einen Seitenblick zu. „Wie geht es Lotte?“, fragte sie.
„Wir sind zu unserem Leben von vor dem Krieg zurückgekehrt. Sie in Berlin, ich in München. Lotte ist wieder in ihrem Element. In Berlin agitiert sie für die Kommunistische Partei. Ich bin jedes Mal dankbar, wenn sie mich heil und unversehrt in München besucht. Aber sie kann nicht anders. Das habe ich inzwischen akzeptiert. Und jetzt habe ich mir ein paar Wochen frei geschaufelt und werde sie besuchen. Darauf freue ich mich schon seit Monaten.“
„Und sonst? Gibt es Neuigkeiten aus München?“, fragte Hilde und versuchte dabei, möglichst neutral zu klingen, auch wenn sie sich ein wenig Sorgen um die Antwort machte.
„Deine Mutter vermisst dich, das ist ja nichts Neues. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, muss ich mir erst einmal eine Klage über ihr Schicksal als einsamer Vogel in einem leeren Nest anhören. Aber sie beruhigt sich dann rasch wieder. Und sie hat genügend Aufgaben, die ihre volle Aufmerksamkeit fordern. Zum einen hat sie viel Arbeit mit der Leitung ihres Betriebes, zum anderen kommt Hermann regelmäßig mit seiner Erika zu Besuch. Du solltest deine Mutter sehen, wie ihr das Herz aufgeht, wenn sie mit ihrer Enkelin spielt.“
„Und wie geht es Hermann?“
Isolde seufzte. „Hermann macht mir Sorgen. Er ist unglücklich. Aber ich habe das Gefühl, dass er sich nicht helfen lassen will, und das bereitet mir Kopfzerbrechen.“
„Die Ilm, die Ilm.“ Die Kinderstimme riss Hilde aus ihren sorgenvollen Gedanken heraus. Sie sah ihren Sohn an, der mit Begeisterung auf das langsam vor sich hin plätschernde Gewässer zeigte. Und auf ihrem Gesicht breitete sich ein Lächeln aus.
***
Hermann rieb sich die Augen. Er spürte wieder diesen leichten Schmerz hinter der linken Schläfe. Wenn er nichts dagegen unternahm, würde sich dieser immer weiter verschlimmern und er würde den Abend in seinem abgedunkelten Zimmer verbringen und hoffen, dass ein gnädiger Schlaf die Pein linderte. Der Tag in der Bank war anstrengend gewesen. Inzwischen stand mindestens dreimal pro Woche eine Krisensitzung mit dem Vorstand auf der Tagesordnung. Die politischen Entwicklungen wurden immer dramatischer und die Wirtschaft lag am Boden. An diesem Tag war die Nachricht in die Vorstandssitzung geplatzt, dass bei einem Protest gegen die französische Besatzungsmacht in Essen mindestens dreizehn Arbeiter der Krupp-Werke ums Leben gekommen waren. Hermann fürchtete, dass die Aufgabe, die Bank durch diese stürmischen Zeiten zu führen, seine Kräfte und Fähigkeiten überstieg.
Der Wagen hielt an. Der Chauffeur stieg aus und öffnete Hermanns Tür. Er trat auf das feucht schimmernde Trottoir und ging die Treppenstufen hinauf zum Eingang des Lampeckschen Palais. Dort erwartete ihn schon Karl, der glatzköpfige Leibdiener mit dem schlohweißen Backenbart, der ihm den Mantel abnahm. Die Salontür stand offen. Hermann spürte ein Gefühl der Vorfreude. Hier wartete etwas auf ihn, das seine Kopfschmerzen zwar nicht vertreiben, ihm aber ein wenig Linderung verschaffen konnte. Er lenkte seine Schritte in Richtung des Salons, doch dann hörte er eine Stimme.
„Papa, Papa“, rief ein kleines Mädchen.
Er wandte seinen Blick und sah ein Kind auf sich zu rennen. Sie strahlte ihn mit einem zahnlückengefüllten Lächeln an, ihre großen, blauen Augen glänzten.
„Papa, Papa“, rief Erika noch einmal und warf sich in Hermanns inzwischen ausgebreitete Arme. Er drückte seine Tochter fest an sich, fühlte ihre Wärme und genoss ganz besonders den frischen Geruch nach Mandeln, der von der Seife herrührte, mit der die Gouvernante das Mädchen wusch.
„Ich dachte, du wärst schon im Bett“, sagte Hermann. Er sah auf die Uhr. Es war kurz vor acht.
„Gutenachtlied“, rief seine Tochter.
Hermann richtete den Blick auf die Gouvernante, eine unscheinbare Frau Mitte 40, deren Haare komplett grau waren und die ihren Arbeitgeber mit einem entschuldigenden Lächeln ansah.
„Die Tochter der Herrschaft hat darauf bestanden, dass Sie ihr ein Gutenachtlied spielen sollen. Vorher wollte sie nicht ins Bett gehen“, erwiderte die Frau.
Hermann schmunzelte. „Ich sehe, du hast alles im Griff, Erika“, sagte er. „Nun, geh in dein Zimmer und leg dich in dein Bettchen, ich hole die Klarinette und komme gleich nach.“
Er stellte seine Tochter auf den Boden, die Kinderfrau nahm sie an der Hand und führte sie in den rückwärtigen Flügel des Palais, wo sich Erikas Kinderzimmer befand. Hermann ging in den Salon. Sein Blick fiel unwillkürlich auf das Schränkchen in der Ecke. Konnte er es wagen? Wenn er einen Schluck Cognac trank, wäre seine Hand vielleicht ein wenig ruhiger. Aber Erika würde es riechen. Sie hatte eine feine Nase und mochte den Geruch des Weinbrands nicht. Seufzend wandte er sich der anderen Ecke des Raums zu und nahm die Klarinette von ihrem Ständer. Aus dem Gefäß auf dem Beistelltisch holte er ein Blatt und spannte es mit geübten Bewegungen auf das Mundstück. Dann verließ er den Salon.
Erika lag in einem Himmelbettchen. Der Stoff über ihrem Kopf war dunkelblau und mit silbernen Sternen und einem Vollmond bestickt. Sie sah ihn mit ihren großen, leuchtenden Augen an.
„Irgendwelche besonderen Wünsche?“, fragte er.
„Guten Abend, gute Nacht“, sagte sie.
Hermann nickte. Das Lied hatte ihr die Gouvernante schon von klein auf vorgesungen. Er hatte den Text stets etwas gruselig gefunden. Dieses: Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt, musste Kindern in Erikas Alter doch furchtbare Angst machen. Er war froh, dass er sich mit den Worten nicht auseinandersetzen musste, denn er spielte nur die Melodie und die mochte er sehr gerne.
Hermann umschloss das Blatt mit den Lippen und blies einen Probeton. Das hörte sich nicht richtig an, weshalb er die Verschraubung der Klarinette noch einmal kontrollierte und nach einer kleinen Korrektur klang es, wie es sollte. Er holte tief Luft und als die Töne aus ihm heraus zu fließen begannen und die einfache, aber doch so schöne Melodie bildeten, fühlte er, wie seine Kopfschmerzen nachließen und wie ein Gefühl des Friedens und der Ruhe sich in ihm ausbreitete. Sein Blick fand Erika, die mit einem seligen Lächeln zuhörte. Waren ihre Augen bereits ein wenig kleiner geworden? Ja, tatsächlich, sie fielen zu. Er war an das Ende der ersten Strophe gelangt und begann mit der zweiten. Nun sank ihr Kopf zur Seite. Die Gouvernante strich ihr übers Haar und lächelte Hermann zu, so als ob sie ihn auffordern würde, aufzuhören, da er seiner Pflicht genüge getan habe. Doch er dachte gar nicht daran. Er spielte eine dritte Strophe, dann ließ er den letzten Ton leise verklingen, setzte die Klarinette ab und ging zu seiner Tochter. Das Lächeln war noch immer auf ihren kleinen Lippen. Er küsste sie auf die Stirn, dann nickte er der Kinderfrau zu und trat in den Flur.
Er blickte sich rasch um. Wie nicht anders zu erwarten, war von seiner Frau in diesem Teil des Palais nichts zu sehen. Sie zeigte wenig Interesse an Erika, vermutlich, weil sie ein Mädchen und nicht der ersehnte Stammhalter geworden war. Er ging in den Salon und begann damit, das Blatt der Klarinette zu lösen und das Instrument ordentlich zu putzen. Vorsichtig stellte er es zurück auf den Ständer. Ein Gefühl der Zufriedenheit breitete sich in ihm aus, doch es war keine Empfindung, die ihn lange Zeit erfüllen konnte. Es war eher wie eine kleine Welle, die kurz durch seinen Körper wusch und dann im Sand versickerte. Das Pochen hinter seiner Schläfe meldete sich. Das war unausweichlich gewesen. Die Musik hatte es nur kurz vertreiben können. Sein Blick fiel auf das Behältnis in der Ecke. Was sich darin befand, war keine Medizin, es war ein Gift, das war ihm durchaus bewusst. Aber es war zugleich ein Mittel, das die Schmerzen und die Verzweiflung in seinem Innern wenigstens für einen Moment mildern konnte. Er ging zu dem Schränkchen, nahm die Karaffe heraus und goss einen Schwall Cognac in das Kristallglas. Und als er den ersten Schluck trank, und ihm der Alkohol beinahe sofort in den Kopf stieg, fühlte er, wie alle Sorgen und Nöte weit in den Hintergrund traten, ebenso wie das Pochen an seiner Schläfe. Er setzte sich in den Ohrensessel, lehnte sich zurück, schloss die Augen und atmete tief aus.
Kapitel 2
Weimar und München, 9. April 1923
Hilde war spät dran. Der Abschied von Paulchen hatte heute wieder etwas länger gedauert und wie so oft war sie hin- und hergerissen. Der enttäuschte Blick ihres Sohnes, als sie das gemeinsame Spiel beenden musste, brach ihr jedes Mal von Neuem das Herz. Doch gleichzeitig freute sie sich auf diesen Tag und war gespannt, welche Aufgaben sie im Vorkurs erwarten würden.
Sie betrat die Hochschule. Die Zeiger auf dem großen Zifferblatt bildeten 8:12 Uhr. Noch zwei Minuten später war es, als sie den Klassenraum erreichte. Johannes Itten, der Meister, der den Vorkurs leitete, saß in der Mitte auf einem Kissen. Er trug eine violette Kutte, hatte die Füße im Schneidersitz untergeschlagen und den Rücken kerzengerade aufgerichtet. Sein Schädel war vollkommen kahl. Die Form erinnerte Hilde an ein Ei. Doch in diesem Kopf, das war ihr in den letzten Monaten bewusst geworden, lebte ein künstlerisches Genie.
Der Blick des Meisters traf sie. Sie sah Missbilligung darin, dass sie zu spät dran war. Die Atem- und Bewegungsübungen, die er zu Beginn anzuleiten pflegte, hatte sie wohl verpasst. Itten unterließ es, sie zu tadeln, vermutlich um die anderen Studenten nicht bei ihren Übungen zu stören. Sie eilte zu dem Tischchen, das noch frei war und kramte rasch Papier und die Bleistifte, die sie immer mit sich führte, aus ihrer Tasche.
„Wir sollen die Zitronen subjektiv erleben und objektiv erkennen“, hörte sie eine Stimme flüstern. Sie wandte den Kopf und sah zu der jungen Frau, die neben ihr saß. Fanny. Sie hatten sich einmal kurz unterhalten, vor einer Feier war das gewesen, zu der sie aber nicht hatte gehen können, weil sie nach Hause musste, um sich um Paulchen zu kümmern. Hilde nickte ihr zu und widmete ihre Aufmerksamkeit der Vorlage, die auf einem Tischchen neben dem meditierenden Meister platziert worden war. Zwei gelbe Zitronen auf einem weißen Teller und daneben ein Buch mit grünem Deckel bildeten ein farbenprächtiges Stillleben. Sie nahm einen mittelharten Bleistift und begann, die räumliche Struktur der Früchte zu skizzieren. Ein Hüsteln riss sie aus ihrer Konzentration. Sie schreckte auf. Irritiert sah sie Itten an, der plötzlich nicht mehr auf seinem Kissen saß, sondern vor ihr aufragte. Er musterte ihre Skizze und die dichte Wolke aus Knoblaucharomen, die ihn stets umgab, nahm ihr kurz den Atem.
„Was machen Sie da?“, fragte er.
Hilde schluckte. „Ich dachte, die Aufgabe bestünde darin, die Zitronen abzuzeichnen“, sagte sie.
„Wären Sie rechtzeitig gekommen, dann wüssten Sie, dass die Aufgabe eine wesentlich schwierigere ist.“
Hilde sah auf das Blatt Papier hinab. So schwierig war ihr das gar nicht vorgekommen. Sie war sehr zufrieden mit dem, was sie produziert hatte. Es sah ziemlich genauso aus wie das Stillleben auf dem Teller, nur die Farben fehlten.
„Ich habe die Zitronen gezeichnet“, sagte sie.
„Ja, das haben Sie“, erwiderte Itten. „Das Bild sieht aus, als ob sie eine Fotografie davon gemacht hätten. Rein technisch ist das ausgezeichnet. Aber darum ging es mir nicht. Sie sollten Ihr Erlebnis von der Frucht zu Papier bringen. Versuchen Sie es erneut.“
Er drehte sich um und ging davon. Hilde spürte, wie ihr Mund trocken wurde. Da war sie einmal zufrieden mit ihrer Arbeit gewesen und dann erwartete der Meister etwas anderes. Was wollte Itten von ihr?
„Die Kunst ist eben nicht jedem gegeben“, hörte sie eine Stimme, die ihr nun aus der anderen Richtung etwas zuraunte. Sie wandte den Blick und erkannte, dass Markus die Worte gesprochen hatte. Sie hatten sich einmal beim Mittagessen kurz unterhalten. Seitdem schien er sie irgendwie auf dem Kieker zu haben. Neulich hatte sie ihn zu einem anderen Studenten sagen hören, dass es doch ein Unding sei, wenn Mütter ihre Kinder vernachlässigten, nur um einem Traum nachzuhängen, der unrealistisch sei. Sie hatte sofort verstanden, dass das auf sie gemünzt gewesen war, auch wenn sie nicht wusste, woher er sich das Recht nahm, ein Urteil über ihre Lebenssituation zu fällen. Nun grinste er sie überheblich an. Sie wandte den Blick ab und hörte nun von der anderen Seite ein Flüstern.
„Es geht darum, die Essenz des Bildes einzufangen, nicht die äußeren Details“, hörte sie Fanny sagen.
Die Essenz des Bildes. Was hatte das zu bedeuten? Sie lehnte sich zurück und sah ein weiteres Mal zu den Zitronen hin. Mit einem Mal erschien eine Szene vor ihrem inneren Auge. Sie sah sich an einem festlich geschmückten Tisch im Garten der Villa ihrer Mutter. Alle waren sie dort versammelt: Tante Isolde und Lotte, Elsa und Hermann. Sogar Onkel Anton war da gewesen. Sie waren glücklich gewesen, eine Familie mit einer goldenen Zukunft. Es hatte Zitronenlimonade gegeben, aber die war so sauer gewesen, dass Hilde das Gesicht verzogen hatte, als sie davon gekostet hatte. Sie schlug sich gegen die Stirn. Das war es.
Hilde nahm einen harten Bleistift und begann, auf einem neuen Bogen Papier einen zweiten Entwurf zu zeichnen. Als sie fertig war, besah sie sich das Bild und schmunzelte. Itten trat zu ihr und sah ihr über die Schulter. Sie roch den Knoblauch und zu ihrer Verwunderung hörte sie den Meister leise kichern.
„Sehr gut“, sagte er. „Jetzt haben Sie die Aufgabenstellung erfasst.“
Fanny linste zu Hilde herüber. „Was hast du gezeichnet?“, fragte sie. Hilde zeigte ihr das Gesicht. Ein Selbstporträt, dessen Miene grotesk verzogen war.
Fanny lachte. „Das müssen aber saure Zitronen gewesen sein.“
***
Hermann rieb sich die Schläfen. Er spürte, wie ein Gähnen in ihm aufstieg und spannte die Kiefermuskulatur an, um es zu unterdrücken. Er wollte nicht, dass die anwesenden Herren einen noch schlechteren Eindruck von ihm bekamen, und hoffte, dass sie unter der Wolke von Parfüm, mit der er sich am Morgen eingesprüht hatte, den Cognac nicht rochen. Aber die wissenden Blicke, die sie sich zugeworfen hatten, als er vor nunmehr zwei Stunden auf seinem Stuhl Platz genommen hatte, ließen ihn vermuten, dass dieses Täuschungsmanöver vergebens gewesen war. Sie wussten, dass er trank. Aber sie waren zu höflich oder zu feige, um etwas zu sagen. Hermann sah zu Krötzinger hin. Der stellvertretende Vorstand der Bank war mitten in seinen Ausführungen.
„Es ist zu erwarten, dass die Teuerungsrate weiter steigt. Die Regierung tut nichts dagegen, sie lässt der Inflation mehr oder weniger ihren Lauf. Der Zentralbankchef hat den Trend in der vergangenen Woche durch den Einsatz von Goldreserven zwar etwas abbremsen können, aber nach meiner Einschätzung, ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die Goldvorräte der Reichsbank sind endlich. Die Besetzung des Rheinlands und die damit verbundenen Kosten für die Regierung, die den streikenden Arbeitern weiterhin ihr Gehalt zahlt, sind enorm. Das bedeutet, dass gleichzeitig der Bargeldbedarf enorm ist, weswegen die Reichsbank immer mehr Banknoten drucken lässt. Und das wird dazu führen, dass die Inflation weiter steigt.“
Herr Bauer, der erst im vergangenen Herbst in den Vorstand aufgestiegen war, nachdem er einige Jahre lang die Filiale der Bank in Stuttgart geleitet hatte, schüttelte den Kopf. „Die Fachleute des Finanzministeriums sind sich doch einig darin, dass die negative Außenhandelsbilanz für die Teuerung verantwortlich ist. Und nicht die Finanzpolitik der Regierung.“
„Das würde ich anstelle der Regierung auch behaupten“, sagte Hermann, der einen Blick mit Krötzinger tauschte. Dieser nickte ihm zu, wie ein Lehrer, der seinen Schüler ermutigen will, einen Vortrag zu halten. Hermann war froh darüber, etwas beisteuern zu können, denn es fiel ihm immer schwerer, den Ausführungen passiv zu folgen. „Die Reichsregierung versucht, die Alliierten zu zwingen, uns in der Frage der Reparationen entgegenzukommen. Durch die Inflation soll das Zeichen gegeben werden, dass Deutschland niemals in der Lage sein wird, die Schadensersatzforderungen zu begleichen. Dass stattdessen Entgegenkommen notwendig ist, eine Reduktion oder gar eine Streichung der Kriegsentschädigungen. Deshalb lässt die Reichsbank immer mehr Geld drucken, um den Bedarf der Regierung zu decken, anstatt dass diese das einzig Richtige täte: Sparen.“
„Aber das muss in einer wirtschaftlichen Katastrophe münden“, sagte Bauer.
Hermann nickte. „Die Reichsregierung ist wohl eher bereit dazu, eine wirtschaftliche Katastrophe zu riskieren als einen neuen Krieg. Und das kann ich ihr nicht übelnehmen.“
Mehrere der anwesenden Herren tauschten Blicke aus. Hermann war das gleichgültig. Sollten Sie doch denken, was sie wollten. Keiner der Vorstände hatte gedient und die meisten waren wahrscheinlich der Überzeugung, man müsse es noch einmal wagen, müsse den Alliierten zeigen, dass Deutschland eine Macht sei, mit der international zu rechnen sei, die sich auflehnen könne gegen die Reparationen. Aber das war Unsinn. Die Republik lag am Boden, militärisch, wirtschaftlich und politisch. Es waren düstere Zeiten.
„Nun, jedenfalls schlage ich vor, dass wir weiterhin in Devisen und Gold investieren, um den Grundstock des Bankvermögens unabhängig von den Entwicklungen der Währung zu halten“, sagte Krötzinger.
Hermann nickte. „Dann versuchen Sie mal Ihr Glück. Ich vermute, dass andere Banken ebenfalls auf diese Idee kommen und dass die Märkte deswegen überhitzt sein werden. Zudem hat die Regierung die Spekulation mit Devisen verboten.“
Auf Krötzingers Lippen erschien ein Lächeln. „Man muss nur wissen, mit wem man Geschäfte macht. Und welcher Art diese Geschäfte sind.“
Hermann beendete die Vorstandssitzung und erhob sich. Während die Herren nun in kleinen Grüppchen ihre Gespräche fortsetzten, ging er in sein Büro. Er atmete tief durch und trat zu dem Schränkchen in der Ecke, schenkte sich einen Cognac ein und trank ihn in einem Zug leer. Es tat so gut. Er schloss die Augen und spürte, wie der Rausch sich beinahe unmittelbar bemerkbar machte. Da klopfte es an die Tür. Er fluchte leise vor sich hin und suchte das Fläschchen mit dem Parfüm. Doch er konnte es nirgendwo entdecken. Verdammt, das hatte er wohl zu Hause vergessen. Die Tür öffnete sich und der Bankdiener sah herein.
„Der General von Steinbeiß möchte Sie sprechen“, sagte er. Hermann unterdrückte einen Fluch. Was wollte sein Schwiegervater denn bei ihm?
„Führen Sie ihn herein“, sagte er.
In dem Moment schob sich der General an dem Bediensteten vorbei, der ihn mit einem fassungslosen Blick musterte. Von Steinbeiß knallte dem Mann die Tür vor der Nase zu und lachte.
„Ich habe dem Kerl erklärt, dass ich keine Anmeldung brauche, um zu meinem Schwiegersohn vorgelassen zu werden. Aber er wollte sich stattdessen an die Regeln des Hauses halten. Nun, dem habe ich gezeigt, wer hier die Gesetze macht.“
Er nahm auf dem Stuhl vor Hermanns Schreibtisch Platz und lehnte sich zurück. Dann musterte er seinen Schwiegersohn mit einem kalten, harten Blick.
„Was kann ich für Sie tun?“, fragte Hermann.
„Zu deinem Versprechen stehen“, sagte der General. Seine Worte waren noch härter als sein Blick.
„Sie brauchen also wieder Geld. Für welche Partei ist es dieses Mal? Für die DNVP? Oder die BVP?“
„Das muss dich nicht bekümmern. Wir haben eine Vereinbarung und daran hältst du dich. Bedenke aber, dass die Kosten steigen. Diese sogenannte Regierung hat die Teuerung nicht im Griff.“
„Die Regierung Kuno setzt die Inflation als Waffe gegen die Alliierten ein. Das sollte Ihnen doch gefallen.“
Der General winkte ab. „Das ist ein stumpfes Schwert. Wir sollten scharfe Waffen gegen unsere Feinde auffahren. Aber damit es dazu kommt, bedürfen wir einer starken Regierung. Und dafür brauchen wir Geld.“
Hermann rollte mit den Augen. „Wie viel ist es dieses Mal?“
„Zehn Millionen fürs erste.“
„Gut, ich werde mich darum kümmern. Auf dasselbe Konto wie immer?“
Der General nickte. Hermann erwartete, dass er sich nun erheben würde, doch von Steinbeiß blieb sitzen.
„Gibt es noch etwas?“, fragte Hermann.
Sein Schwiegervater funkelte ihn an. „Friederike und du, ihr habt euch schon lange nicht mehr in der Gesellschaft gezeigt. Ich erwarte von euch, dass ihr präsenter seid. Auch das ist Teil unserer Vereinbarung.“
Hermann unterdrückte ein Stöhnen. „Nun gut, dann muss ich wohl in den sauren Apfel beißen und meine Frau in die Oper ausführen.“
Kapitel 3
Weimar und München, 23. April 1923
Hilde legte ihre Hand auf die Stirn ihres Sohnes. Sie war heiß und die Haut war feucht. Zwar glühte sie nicht und Paulchen machte einen aufgeweckten Eindruck, obwohl ihm die Nase lief und er immer wieder husten musste. Aber krank war er. Das war eindeutig. Sie sah auf die Uhr. Es war Viertel vor acht. Sie würde ohnehin zu spät kommen. Die Frage war, ob sie überhaupt an die Hochschule gehen oder besser zu Hause bei ihrem kranken Kind bleiben sollte.
„Sputen Sie sich“, sagte Frau Gerwig. Sie machte ein ungeduldiges Gesicht und Hilde konnte es ihr nicht verdenken. Aus der Sicht der Gouvernante war es einfach. Schließlich hatte Hilde sie für Fälle wie diesen engagiert, damit sie ihr den Rücken freihielt und sich um Paulchen kümmerte. Aber dann sah sie ihren Sohn an, der in seinem Bettchen lag, den Rotz hochzog und vor sich hin hustete, die glühenden Augen auf sie gerichtet. Es war unendlich schwer, ihn zurückzulassen, auch wenn sie wusste, dass er bei der Kinderfrau in guten Händen war.
„Ich werde gleich nach dem Unterricht zurückkehren“, sagte sie.
„Das müssen Sie nicht“, erwiderte Frau Gerwig. „Ich werde Thymiantee aufbrühen und ihn ihrem Sohn in kleinen Schlucken einflößen. Sie werden sehen, heute Abend wird es ihm schon besser gehen. Es ist eine leichte Erkältung. Kinder in diesem Alter trifft so etwas immer wieder.“
Hilde schluckte. Natürlich konnte die Gouvernante auf einen reichen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sie hoffte, dass ihre Einschätzung richtig war, dass es sich nur um eine leichte Erkältung handelte und dass ihr Sohn bald wieder gesund sein würde. Aber sie hatte auch anderes erlebt. Sie erinnerte sich an die Spanische Grippe, wie man sie nun nannte. Die Seuche, die ihren Großvater und Zenzi das Leben gekostet hatte. Sie wollte sich nicht vorstellen, Paulchen an eine Krankheit zu verlieren. Er war ihr ein und alles. Sie sah ihren Sohn noch einmal an und drückte ihm einen Kuss auf die Stirn. Dann erhob sie sich, zog ihre Jacke an und zwang sich, die Wohnung zu verlassen. Die Stiegenbretter knarrten und quietschten, als sie die Treppe hinunter eilte und auf die Straße trat.
Sie hatte eine Unterkunft im zweiten Stock eines Hauses in der Innenstadt bezogen. Schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite lag das Schillerhaus. Und jeden Morgen, auf dem Weg zum Bauhaus, kam sie an Goethes Anwesen vorbei. Es war surreal. In der Schule in München hatten die Lehrerinnen von den beiden Poeten wie von entrückten Göttern gesprochen. Aber hier in Weimar hatten sie gelebt und an jeder Ecke wehte der Geist der Klassiker.
Als sie endlich in der Hochschule eintraf, zeigte die große Uhr in der Eingangshalle zwanzig nach acht. Die Gänge waren leer – natürlich – die Studenten waren in den Unterrichtsräumen. Sie betrat das Klassenzimmer, in dem sie das gleiche Bild vorfand wie am Tag zuvor. Itten thronte in der Mitte, die Schüler um ihn herum waren mit ihrer Arbeit beschäftigt. Immerhin wusste sie heute, was zu tun war, der Meister hatte ihnen die Aufgabe gegeben, seinen Farbkreis zu illustrieren. Itten hatte eine eigene Farbenlehre entwickelt, was Hilde großen Respekt einflößte, insbesondere, weil er sich damit in Weimar der Blasphemie schuldig machte, da Goethe hier seine berühmten Überlegungen zum Verhältnis der Farben zueinander angestellt hatte.
Sie nahm Platz und spürte dabei die Blicke der anderen auf sich. Der Meister sah sie jedoch nicht an. Er hatte die Augen geschlossen. Sein hageres Gesicht bewegte sich nicht. In welchen Sphären er wohl weilte? Er gehörte einer fernöstlichen Glaubenslehre an, ernährte sich vegetarisch und verbrachte viel Zeit damit, zu meditieren. Einige ihrer Mitstudenten hatten sich zu dieser Lehre bekehrt und bildeten nun eine Art Jüngerkreis um Itten. Sie trugen Kutten und ernährten sich fleischlos. Aber Hilde gehörte nicht dazu. Überhaupt fühlte sie sich kaum als Studentin, weil sie sich nicht ins soziale Leben Weimars stürzte, sondern abends bei Paulchen saß, ihm vorsang und ihm Bilderbücher vorlas, die sie teilweise selbst illustriert hatte.
Hilde holte ihren Wasserfarbkasten aus der Tasche und ging ins Eck, um sich in dem dort bereitstehenden Wassereimer einen Becher füllen. Dann kehrte sie zu ihrem Tisch zurück, nahm einen Pinsel und mischte aus der Grundfarbe Blau und der Sekundärfarbe Grün eine Tertiärfarbe an, die, wie sie hoffte, dem Blaugrün entsprach, das links im Farbkreis beheimatet war.
„Na, hast du ausgeschlafen?“, hörte sie eine Stimme zu ihrer Rechten. Sie rollte mit den Augen. Es war Markus. Sie sah nicht hin und hoffte, dass er dann von ihr ablassen würde, aber offenbar erreichte sie damit das Gegenteil.
„Aha, du bist wohl zu fein, um mit mir zu reden.“
Nun wandte sie ihm doch den Blick zu. Er grinste sie herausfordernd an.
„Nein, ich bin ich zu fein. Aber ich möchte mich auf meine Arbeit konzentrieren. Wie du sicher bemerkt hast, bin ich spät dran.“
„Und das nicht zum ersten Mal. Auch für dich gelten Regeln“, sagte Markus. Hilde unterdrückte ein Seufzen. Sie wollte etwas erwidern, doch da hörte sie ein Räuspern. Sie erstarrte und sie sah zum Meister hin, der die Augen geöffnet hatte und sie musterte. Das Grinsen auf dem Gesicht ihres Mitstudenten verbreiterte sich. Würde Itten ihr nun eine Strafpredigt halten?
„Wie Markus richtig bemerkt, sind Sie zu spät“, sagte er.
„Mein Sohn ist krank. Ich musste mich noch darum kümmern, dass er gut versorgt ist“, erwiderte Hilde.
Der Meister nickte. „Die Sorge und Liebe um unsere Mitkreaturen ist das wichtigste im Leben.“
Hilde atmete tief durch. Sie hatte eine Ermahnung erwartet und stattdessen Mitgefühl erhalten. Sollte sie etwas erwidern? Aber Itten hatte die Augen schon wieder geschlossen. Sie sah zu Markus hin, der das Gesicht verzogen hatte und die Lippen aufeinanderpresste. Er hatte sich wohl eine Standpauke für Hilde gewünscht. Nun, man bekam eben nicht immer das, was man wollte. Sie zwinkerte ihm zu und widmete sich wieder ihrem Farbkreis.
***
„Oh, der hat aber ein weiches Fell“, sagte Erika. Sie streichelte dem Hasen über den Rücken. Das Tier mümmelte und sah nicht besonders glücklich aus. Hermann war jederzeit auf dem Sprung, es seiner Tochter wegzunehmen, wenn sie zu grob sein sollte. Aber sie strich ihm behutsam und zärtlich über das Fell.
„Hast du den Hasen extra wegen Erika gekauft?“, fragte er seine Mutter.
Elsa schmunzelte. „Eigentlich wollte ich mir Handschuhe machen. Du weißt doch, dass ich in den letzten Jahren etwas verfroren bin. Und Hasenfellhandschuhe sind das beste Mittel gegen kalte Finger. Aber nachdem meine Enkelin so große Freude an diesem Tier hat, komme ich wohl nicht dazu, ihm das Fell über die Ohren zu ziehen.“
„Nein, nicht Fell über die Ohren ziehen“, rief Erika und drückte den kleinen Hasen fest an sich, der ein hilfloses Gesichtchen machte und noch eifriger vor sich hin mümmelte.
Hermann spürte, wie sich eine angenehme Wärme in ihm ausbreitete. Es war das gleiche Gefühl, das er empfand, wenn er etwas getrunken hatte, doch nun war es reiner und unschuldiger.
Sie ließen Erika mit dem Hasen zurück und gingen in Richtung des persischen Pavillons ganz am Ende des Gartens. Die ersten etwas wärmeren Sonnenstrahlen drangen durch das Blätterdach und der Rasen war schon saftig grün. Sie nahmen auf der Bank Platz.
„Wie stehen die Geschäfte?“, fragte er seine Mutter.
„Es wird dich vielleicht überraschen, aber ich kann mich nicht beklagen. Ich profitiere davon, dass ich mehrere Rinderfarmen in Argentinien aufgekauft habe. Die Gauchos liefern mir bestes Leder und ich kann die fertigen Produkte vor Ort wieder in Pesos verkaufen, wodurch ich an frische Devisen komme. Und das beste daran: Es ist alles legal.“
Hermann nickte. „Ja, du finanzierst deinen Betrieb damit überwiegend durch ausländische Währung und hast ein sicheres Fundament. Ich wünschte, jeder Unternehmer wäre so weitsichtig.“
„Nicht jeder hat die Möglichkeit, seine Rohstoffe aus dem Ausland zu beziehen und die fertigen Produkte dann wieder dorthin zu verkaufen.“
„Ja, vor allem wer auf Kohle und Stahl angewiesen ist, hat es zurzeit schwer. Ich hoffe, die Franzosen ziehen bald ab. Und ich hoffe, dieser Generalstreik war nicht eine Verschwendung von Ressourcen, Geld und letztendlich auch von Menschenleben.“
Elsa seufzte. „Ich befürchte, die Franzosen werden den längeren Atem haben. Diese Inflation bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich komme kaum damit nach, die Löhne meiner Arbeiter an die steigenden Kurse anzupassen. Wenn das so weiter geht, werden Lebensmittel unerschwinglich teuer. Die Leute werden hungern. Und schlussendlich wird es zu Aufständen kommen. Aber wir werden sehen. Lass uns über etwas Angenehmeres reden. Was macht das Klarinettenspiel?“
Auf Hermanns Gesicht erschien ein Lächeln. „Es macht mir große Freude. Und ich kann mich inzwischen rühmen, das Instrument einigermaßen zu beherrschen. Erika möchte, dass ich ihr abends ein Wiegenlied vorspiele. Und ich kann mich inzwischen sogar schon an leichtere Stücke von Mozart wagen. Das ist eine große Freude.“
„Heißt das, dass deine Hand wieder ganz verheilt ist?“
Hermann schüttelte den Kopf. „Gerade wenn das Wetter wechselt, habe ich noch Schmerzen. Aber es ist nicht mehr so schlimm wie früher und die Finger sind beweglich. Mehr kann ich wohl nicht mehr erwarten. Im Vergleich zu dem, was viele meiner Kameraden als Verletzungen aus dem Krieg zurückgebracht haben, ist das eine Kleinigkeit.“
„Und wie läuft es mit Friederike und ihrem Vater?“
Hermann verzog das Gesicht. „Wir wollten doch über etwas Erfreulicheres reden“, sagte er.
Elsa legte ihm eine Hand auf die Schulter. „Ist es so schlimm?“
„Ich weiß nicht, ob ich das als schlimm bezeichnen soll. Und vielleicht ist gerade das das Furchtbare daran. Wir sind verheiratet, aber wir führen zwei getrennte Leben. Ich kann gar nicht behaupten, dass mir das unangenehm wäre. Friederike lässt mich in Ruhe. Und ich störe ihre Kreise nicht. Im Alltag habe ich sogar mehr Kontakt mit ihrem Vater als mit ihr. Der kommt regelmäßig zu mir und will Geld für irgendwelche deutsch-nationalen Parteien.“
Hilde runzelte die Stirn. „Aber doch hoffentlich nicht für diesen Hitler. Der Mann ist mir irgendwie unheimlich.“
Hermann zuckte mit den Schultern. „Ich weiß nicht, für wen er das Geld verwendet, letztendlich ist es mir gleichgültig.“
„Irgendwo muss das doch ein Ende haben. Du kannst doch nicht unendliche Geldmittel aufwenden, um die politischen Ambitionen deines Schwiegervaters zu finanzieren.“
„Doch, leider. Er weiß zu viel. Über Lotte, aber auch über Paul und Hilde. Ich darf sie nicht in Gefahr bringen. Und sieh es einmal positiv. Das Geld, das ich ihm gebe, ist in ein paar Wochen schon wieder wertlos. Ich hüte mich davor, ihm Devisen zu überweisen.“
Auf den Lippen seiner Mutter erschien ein Lächeln. „Ich sehe, du bist ganz mein Sohn. Aber ich hätte dir gewünscht, dass du glücklich wirst. Ganz besonders in der Liebe.“
Hermann seufzte. Mit einem Mal war er wieder da, dieser Druck, die schlimmen Gefühle, die nun aufkeimten, in Cognac zu ertränken. Er wusste, dass seine Mutter keine harten Alkoholika im Haus hatte. Deshalb zerbrach er sich den Kopf, wie er ungesehen einen kräftigen Zug aus dem Flachmann nehmen konnte, den er in der Innentasche seines Jacketts als eiserne Reserve mit sich führte.