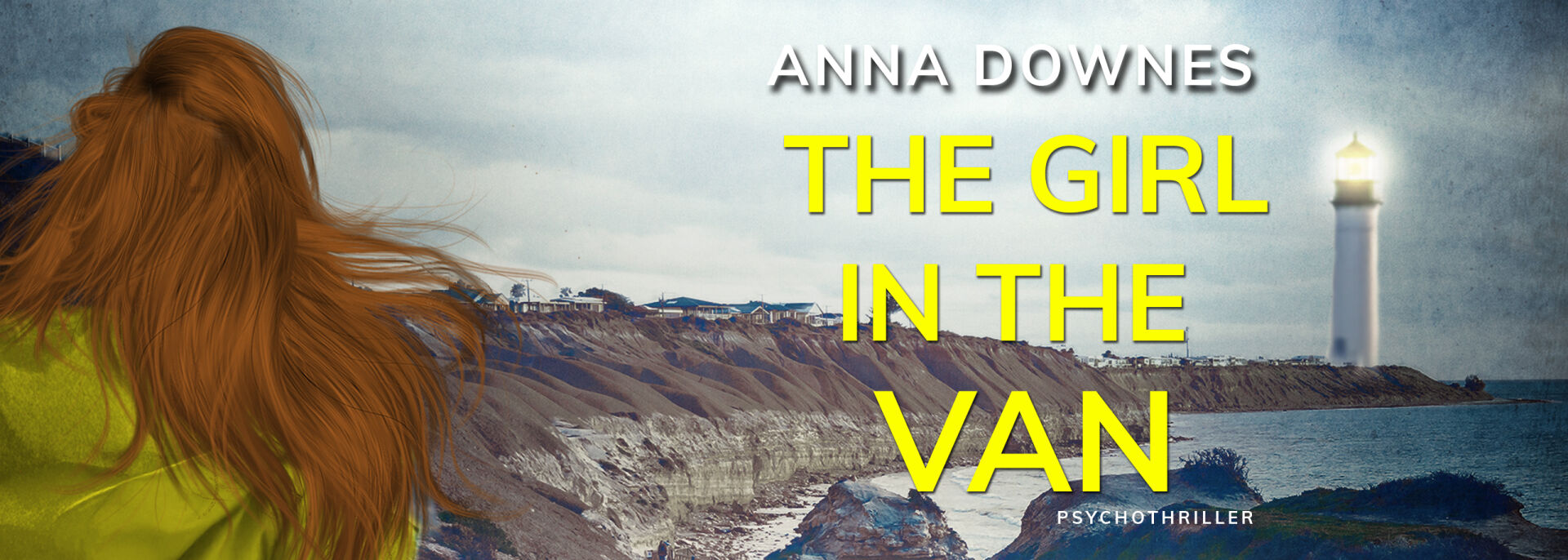Kapitel Eins
Katy
Ich habe einen Fehler gemacht.
Das wird mir klar, als ich merke, wie mir die Augen zufallen und der Kopf auf die Brust herabsinkt. Ich sauge scharf die Luft ein, setze mich aufrecht hin und klammere mich fester ans Lenkrad. Ich blinzele und die Straße vor mir wird wieder scharf. Der staubige Asphalt fließt unter mir entlang wie ein reißender Fluss, die unterbrochene weiße Linie leuchtet im Licht meiner Scheinwerfer. Zu beiden Seiten verliert sich der rote Schmutz im schwarzen Nichts.
Mein Herz beginnt zu rasen. Bin ich gerade eingeschlafen? Ich werfe einen Blick auf den Tacho: Ich bin fast zwanzig zu schnell. Verdammt. Ich wische mir über das klamme Gesicht und suche mit dem Fuß die Bremse. Der Van wird langsamer.
Der Abend ist ruhig, außer mir sind keine anderen Fahrzeuge unterwegs, aber trotzdem fühlt es sich an, als wäre es knapp gewesen. Ich hätte leicht von der Straße abkommen und gegen einen Baum prallen können, oder mit einem vorbeikommenden Känguru zusammenstoßen. Ich hätte einen echten Menschen überfahren können. Ich kann mir nur zu gut denken, was Phoebe sagen würde, wenn sie jetzt hier wäre. Bist du übergeschnappt, Babe? Hör auf deinen Verstand und fahr rechts ran. Weißt du denn gar nicht, wie man sich schützt? Wie ironisch.
Im Westen ziehen sich goldene Streifen über den Horizont. Es ist so schnell Nacht geworden. Der Himmel war doch vor wenigen Minuten noch hell?
Ich fahre weiter. Bei Dunkelheit zu fahren, ist vielleicht nicht sicher, aber über Nacht am Straßenrand zu halten, ist auch keine Option. Und umkehren kann ich nicht. Ich hatte guten Grund, überstürzt aufzubrechen … oder?
Ich versuche mich zu erinnern. Warum bin ich noch mal los? Ich war auf einem Campingplatz. Da war so ein Kerl. Ich habe mich nicht wohlgefühlt. Und wenn man sich komisch fühlt, sollte man verschwinden. Eine Grundregel des Reisens. Aber warum genau habe ich mich so gefühlt? Ich weiß es nicht mehr genau, meine Erinnerung ist verschwommen – was nicht ungewöhnlich für mich ist. Ich kann oft nicht genau sagen, wo meine Gefühle herkommen. Aber dann weiche ich abrupt einem Schlagloch aus und etwas rollt gegen meinen Fuß, knallt gegen meinen Knöchel. Ich greife nach unten und ziehe eine fast leere Weinflasche aus dem Fußraum. Oh. Die Flüssigkeit schwappt gegen den Deckel der Flasche und mir dreht sich der Magen um. Oh nein. Ich fahre mir mit der Zunge über die Wange und schmecke Brombeere und Tannin. Die Erkenntnis trifft mich wie ein Sandsack: Ich bin nicht einfach nur müde. Ich bin betrunken.
Meine Haut kribbelt vor Scham und ich klemme die Flasche zwischen meinen Sitz und die Tür, wo sie den Hals hervorstreckt, wie ein kleiner Mensch, der etwas sagen will. Nein. Ich werfe ihr einen bösen Blick zu. Halt den Mund. Von ihren vollen Freundinnen hinten im Van will ich auch nichts hören, auch wenn ich ihre Präsenz deutlich spüren kann. Schaut mich an, ich schaffe nicht mal einen vollen Tag auf der Straße, bevor ich mir selbst ein alkohol-befeuertes Drama einbrocke.
Ich kann nur vermuten, was da hinten wirklich passiert ist. Ein freundlicher Reisender hat versucht, ein Gespräch mit mir anzufangen und ich bin ausgerastet, habe total überreagiert und mich hinters Steuer gesetzt, obwohl ich zu viel getrunken hatte. Wäre nicht das erste Mal.
Ich greife nach der Flasche Wasser im Getränkehalter und schraube den Deckel ab. Ich stürze die halbe Flasche auf einmal hinunter, gierig, als würde die lauwarme Flüssigkeit all meine schlechten Gefühle wegspülen.
Ich fahre immer weiter und weiter. Der Himmel wird dunkler; der goldene Streifen wird erst pink und dann lila. Ich werfe einen Blick auf das Navi. Meine nächste Station ist noch knapp zwei Stunden weg. Bis dahin wird es stockdunkel sein. Ich habe eine Reservierung, aber erst für morgen. Vielleicht können sie mich schon vorher einchecken lassen, wenn ich vorab anrufe? Ich greife nach meinem Handy, aber erstarre, als mich ein Licht durch den Seitenspiegel anfunkelt. Scheinwerfer. Ein Auto, das auf der Straße zu mir aufholt.
Langsam lege ich die Hand wieder ans Steuer. Einundzwanzig, zweiundzwanzig, dreiundzwanzig. Ich blicke wieder in den Spiegel. Das Licht verschwindet, als ich um die Kurve fahre und taucht dann wieder auf, als das Auto es mir gleichtut. Beruhig dich. Das ist eine Straße. Natürlich tauchen da auch andere Fahrzeuge auf. Trotzdem bleibe ich wachsam.
Ich mache das Radio an. Auf einem lokalen Sender läuft eine schmierige Saxophonnummer, sehr frühe 90er. Das Lied verklingt und wird von einem Nachrichteneinspieler abgelöst. „Kommen wir zu den Nachrichten“, sagt der Sprecher. „Die Familie der Vermissten Vivi Green erhöht den Druck auf die Polizei, ihre Suche nach der Alleinreisenden auch auf den Cape Range Nationalpark auszuweiten. Diese Forderung kommt nach einer…“
Ich schalte wieder aus. Die Luft um mich fühlt sich plötzlich heiß und klebrig an. Ich mache die Klimaanlage an und das leise Rauschen des Ventilators gesellt sich zum Surren des Motors. Ich setze mich anders hin. Die Nadelköpfe hinter mir sehen aus wie Augen, die immer näher und näher kommen. Und die sich, wie mir dann auffällt, bewegen. Hin und her gleiten sie. Ich kneife die Augen zusammen und blicke in den Rückspiegel. Durch den dunklen Tunnel meines Vans beobachte ich, wie das Auto auf die Gegenspur wechselt und sich dann wieder hinter mir einordnet.
Etwas stimmt nicht. Ich senke den Fuß und beschleunige so sehr, wie ich mich traue. Aber als ich wieder in den Rückspiegel sehe, hat das Auto mitgehalten. Ein Blick auf den Tacho sagt mir, dass ich nicht noch schneller fahren kann, ich bin jetzt schon über der Geschwindigkeitsbegrenzung. Also ändere ich meine Taktik und mache langsamer, damit der andere Fahrer mich überholen kann. Aber das Fahrzeug wird auch langsamer, bleibt ganz dicht hinter mir und pendelt hin und her, hin und her.
Mir fällt auf, dass wir auf eine Abzweigung zufahren und ich bremse und setze den Blinker, damit der andere Fahrer genügend Zeit hat, um an mir vorbeizufahren. Aber das Auto wird schneller, wächst im Spiegel immer weiter, und es blinkt nicht, überholt nicht, es kommt genau auf mich zu und es wird in mich hineinfahren –
Im letzten Moment reiße ich das Lenkrad herum und lande mit meinem Van im Kies, lange vor der Kreuzung. Meine Reifen wirbeln Staubwolken auf und das Auto schießt als Streifen von Licht und Lärm an mir vorbei. Ich recke den Hals, als es vorbeifährt, um einen Blick auf den Fahrer oder das Nummernschild zu erhaschen, aber ich sehe nur abgedunkelte Fenster und den massiven Umriss eines militärisch aussehenden Wohnmobils.
Ich komme jetzt ganz zum Stehen und sitze bei laufendem Motor im Dunkeln. Ich wage es kaum zu atmen und erwarte fast, dass die Scheinwerfer noch einmal zurückkommen, frage mich, was ich tue, falls das passiert. Aber die Rücklichter verschwinden und die Straße ist wieder leer. Ich ärgere mich über mich selbst, dass ich nicht früher angehalten habe, dass ich überhaupt so spät losgefahren bin, dass ich nicht geschafft habe, „auf meinen Verstand zu hören“.
Zitternd treibe ich den Van an, auf die Seitenstraße, wo ich noch ein kurzes Stück rolle, bevor ich den Motor ausmache. Ich nehme die Hände vom Lenkrad und vergrabe mein Gesicht in ihnen. Ich bin so aufgedreht, dass ich meinen Herzschlag in meinen Augäpfeln fühlen kann.
Gleichzeitig rollt Erschöpfung wie eine Welle auf mich zu. Die lange Fahrt, die übertriebene Wachsamkeit, der Alkohol, das Auto, das mich von der Straße gedrängt hat … Die Mischung aus allem trifft mich wie ein Narkosemittel und bleierne Müdigkeit überkommt mich. Mir fallen langsam die Augen zu.
Es ist so ruhig. Ich muss mich ausruhen. Ich brauche Schlaf. Ich schwebe davon …
Es ist das Geräusch von Rascheln im Gras und knackenden Zweigen, das mich aufweckt.
Ich reiße die Augen auf und starre durch die Windschutzscheibe, beobachte die Schatten draußen. Augenscheinlich ist noch alles gleich. Ich bin immer noch im Van, parke am Straßenrand, es ist immer noch dunkel draußen. Aber ich weiß intuitiv, dass sich etwas verändert hat.
Ich mache das Licht in der Fahrerkabine an und schalte dann die LEDs hinten drin an. Ihr schwaches Licht quillt aus den Fenstern und beleuchtet den Boden rund um den Van, aber nicht viel mehr.
Dann bemerke ich rechts von mir eine Bewegung. Ein Ast, der sich im Wind wiegt? Ein Tier auf der Jagd? Ich drücke das Gesicht ans Fenster, lege die Hände an die Scheibe. Vielleicht habe ich es mir nur eingebildet. Aber nein, da passiert es noch einmal. Eine Störung, eine Kräuselung auf der Oberfläche der Nacht. Da draußen bewegt sich etwas.
Ich weiß, dass ich sitzenbleiben sollte, dass es drinnen viel sicherer ist als draußen, aber ich kann mich nicht davon abhalten, die Tür aufzustoßen und nach draußen auf die kalte Erde zu treten. Es sieht so aus, als wäre die Straße viel schmaler, als ich zunächst gedacht hatte, kaum mehr als ein Schlammpfad durch das Gestrüpp, der wahrscheinlich nur zu einem Bauernhof führt. Daran, ihm zu folgen, habe ich aber gar kein Interesse; das letzte, was ich jetzt gebrauchen kann, ist irgendein gruseliges altes Haus. Stattdessen drehe ich mich zur Autobahn zurück, aber ich kann sie in der Dunkelheit gar nicht sehen. Es ist, als wäre ich meilenweit in die Wildnis hineingefahren, statt nur ein paar Meter.
Nach und nach werden mir die Laute bewusst, die wie Libellen in der Luft schweben. Insekten, Blätter, der Wind, Frösche. Und menschliche Laute. Schnaufen, Schritte, knirschender Kies.
„Hallo?“
Ich ziehe mein Handy hervor und mache die Taschenlampe an. Der Schein ist so schwach, dass er nur die Schatten direkt vor meinen Füßen vertreibt, aber ich könnte schwören, dass ich vor mir jemanden sehe. Mein Herz stockt. Ja. Da vorne, auf der Straße. Eine Frau. Die Gelb trägt.
„Phoebe?“
Ich atme ein und ein süßer, vertrauter Geruch steigt mir in die Nase.
„Pheebs? Bist du das?“
Es widersetzt sich jeder rationalen Erklärung, aber ich bin überzeugt, dass sie es ist. Sie ist hier. Ich halte mein Handy in die Höhe, und gehe einen Schritt nach vorne, dann noch einen, obwohl ich darauf achte, dass ich auf der Straße bleibe. Ich werde schneller und lasse den Van hinter mir. Bäume ragen um mich herum auf wie Riesen, ihre Rinde glatt und zerknittert wie Hautfalten. Irgendwo in der Nähe höre ich Wasser plätschern. Der Horizont ist voll von Hügeln, die sich pechschwarz vor dem endlosen, mit Sternen übersäten Himmel aufblähen.
Irgendwann bleibe ich stehen. Ich kann sie nicht mehr sehen, nicht mehr hören. „Phoebe?“
Die Straße ist leer. Der rote Dreck hat sich in Sand verwandelt, die Bäume wurden von Seegras abgelöst. Das Meer ist ganz nah.
„Bitte“, flüstere ich zitternd. „Bitte komm zurück.“ Aber hier ist niemand außer mir, keine andere Stimme, kein Herzschlag. Ich habe mich geirrt. Sie ist nicht hier. Ich bin allein.
Plötzlich bleibt mir der Atem weg. Ich kann ihr Gesicht nicht mehr vor mir sehen – ihr echtes Gesicht, nicht das aus Fotos und Videos, sondern wie sie in Fleisch und Blut war. Wimpern, Sommersprossen, Haar, Narben. Die Falten auf ihrer Stirn und um ihre Mundwinkel. Das alles entgleitet mir wie Sand, der durch meine Finger rinnt. Ich fange an, sie zu vergessen.
Ich lehne mich nach vorne und stütze mich auf meinen Knien ab. Reiß dich zusammen! Ich mache eine Liste.
Sie hat beim Fahren gerne Äpfel gegessen und dann immer braune, verschrumpelte Kerngehäuse im Getränkehalter gelassen.
Sie hat es gehasst, wenn Leute laut gegessen haben.
Sie hat immer die letzten paar Schlucke eines Getränks übrig gelassen, ohne jeglichen Grund dafür.
Sie mochte Haarklammern lieber als Haargummis und hat sie gerne mit buntem Nagellack dekoriert. Wenn die Sonne darauf geschienen hat, haben sie in ihrem Haar geglitzert wie Edelsteine.
Leute haben ihr oft gesagt, dass die Sonne aufgeht, wenn sie einen Raum betritt, und es hat gestimmt.
Langsam, ganz langsam beruhigt sich mein Atem wieder. Ich wische mir mit dem Handrücken über die Augen. Ich benehme mich wie ein Baby. Aber ich bin schließlich hier, oder nicht? Ich hab's geschafft. Und ich habe eine Aufgabe zu erledigen.
Ich gehe denselben Weg, wie ich gekommen bin, zurück zum Van. Ich klettere hinein und schiebe mich hinter das Lenkrad. Willkommen zurück am Anfang.
Ich beschließe, dass Weiterfahren das geringere Übel ist. Wo ich auch gerade bin, entweder stimmt hier etwas nicht, oder ich halluziniere, und das sind beides Probleme, die sich durch Dunkelheit und Einsamkeit nicht lösen lassen. Es ist eine viel bessere Idee, den nächsten Campingplatz zu finden und die Gesellschaft anderer Menschen zu suchen. Und jetzt hatte ich wenigstens ein Nickerchen.
Ich schalte den Motor an, wende den Van und folge der Straße zurück auf die Autobahn.
Am Anfang ist es nur ein Gefühl. Eine Druckveränderung, als wäre ich in tiefes Wasser getaucht. Ich kann es nicht genau bestimmen, aber sobald meine Reifen auf dem Asphalt aufkommen, weiß ich, dass etwas nicht stimmt.
Stirnrunzelnd sehe ich in den Rückspiegel und suche nach Scheinwerfern, aber dieses Mal ist kein zu schnelles Auto hinter mir. Ich überprüfe auch die Seitenspiegel, mein Blick springt von der Straße vor mir zu der hinter mir und wieder zurück. Nichts. Aber dann fällt mir etwas ins Auge.
Ich passe den Winkel des Rückspiegels so an, dass ich das Innere des Vans sehen kann, drehe ihn in Richtung Boden und dann hoch, auf die Wände – und da sehe ich es. Ein Beben, als würde die Decke atmen, als wäre der Van selbst am Leben.
Und dann höre ich es, ein leises hih-hah, hih-hah, ein Echo meines eigenen Atems. Ich atme ein und höre es widerhallen, ich atme aus und ein zweiter Luftschwall ertönt im Van. Mir rutscht das Herz in die Hose: es ist dasselbe Gefühl, wie der Moment, in dem sich die Achterbahn nach unten neigt.
Die Decke atmet wirklich. Sie hat eine seltsame Form, ganz ausgebeult. Die Matratze ist uneben.
Es trifft mich wie ein elektrischer Schlag.
Ich bin nicht allein.
Kapitel Zwei
Beth
Von allen Entscheidungen, die Beth Randall in ihrem Leben getroffen hat, gehört die, sich in einen fremden Van zu schleichen und dort im Bett zu verstecken, sicher zu den schlechtesten.
Als sie hört, wie der Fahrer – die Fahrerin? – die Tür aufmacht und sich hinter das Steuer setzt, drückt sich Beth ganz flach auf die Matratze, als könnte sie irgendwie darin versinken. Als der Motor angeht, beginnt sie zu schwitzen. Und als sich der Van in Bewegung setzt, gerinnen ihre Gedanken zu einer einzigen Überzeugung: Das hier wird mein Ende sein.
Es ist natürlich ihre eigene Schuld. Was hat sie sich nur dabei gedacht, sich so in die Falle zu begeben? Hat sie denn aus dem letzten Jahr gar nichts gelernt? Aber sie hatte keine Wahl! Sie war schon so lange gerannt, dass ihre Füße bluteten, ihre Beine sich in Zement verwandelt hatten und jeder Atemzug Feuer in ihrer Lunge war. Weiter, hatte sie sich immer wieder gesagt. Du schwache kleine Idiotin, wag es ja nicht stehenzubleiben. Jeder Schritt schickte Schockwellen von ihren Fußsohlen zu ihrer Schädeldecke und entfachte den Schmerz ihrer Verletzungen erneut.
Zuerst war der Campingwagen nur ein warmes Leuchten in der Dunkelheit. Eine Laterne? Ein Lagerfeuer? Nein – ein Van, ganz versteckt neben der Straße, mit allen Lichtern an. Ein HiAce, stellte sie bei näherer Betrachtung fest, so ein toller umgebauter, wie man sie heutzutage überall sah.
„Hallo?“, rief sie, als sie darauf zuging. Zumindest versuchte sie zu rufen, aber ihre Stimme war kaum mehr als ein Krächzen. „Irgendwer zu Hause?“ Sie wollte den Fahrer nicht erschrecken. Sie wusste genau, wie Menschen reagieren, wenn sie Angst haben. Keine Antwort.
Der weiße Van war mit rotem Staub und Schlammspritzern bedeckt. Ein Blick durch das Fenster zeigte ihr ein hübsches, aber chaotisches Inneres: Lichterketten und Kissen, Schränke und Schubladen, eine Spüle und ein Kühlschrank. Ein netter kleiner Sessel und ein Bett, auf dem die Decke zurückgeschlagen lag, als wäre jemand gerade erst daraus aufgestanden. Handtücher lagen auf der Küchenzeile, achtlos weggeworfene Kleidung, eine Schneewehe aus Snackverpackungen und Papierknäueln türmte sich in der Ecke auf. Aber nirgendwo ein Fahrer.
Und dann schnitt ein Geräusch durch die Stille: das leise Brummen eines Motors auf der Autobahn. Sie wirbelte herum und sah in der Ferne Scheinwerfer auftauchen. Scheiße. Ohne nachzudenken, zerrte sie an der Seitentür des Vans und brach fast vor Erleichterung zusammen, als diese ohne Widerstand aufging. Sie schob sich durch die Lücke und zog die Tür wieder zu, bevor sie sich ganz flach auf den Boden drückte.
Atemlos wartete sie, die Wange gegen die Fasern der gestreiften Bodenmatte gepresst. Eine Hälfte ihres Gehirns war noch mit der unmittelbaren Bedrohung beschäftigt, die andere wandte sich der Frage der Schlüssel zu. Wie wahrscheinlich war es, dass der Fahrer sie zurückgelassen hatte? Könnte es wirklich so einfach sein? Aber das Auto draußen wurde lauter, die Scheinwerfer näherten sich. Fuck. Sie sah sich um, sah die Fenster und die leuchtenden Lichterketten. Der Van war wie ein Signalfeuer, und man müsste es ihr nur gleichtun und durch das Fenster sehen und das Spiel wäre aus. Wo war der Lichtschalter?
Dann erstarrte sie. Schritte. Da kam jemand. Mit klopfendem Herzen kletterte sie auf das Bett, zog die Decke über sich und rollte sich zu einem Ball zusammen. In dem Moment war es ihr wie eine gute Idee vorgekommen, sich hier zu verstecken, aber vielleicht wäre es besser gewesen, weiter zu laufen? Was für eine Scheiße, dass man hinterher immer schlauer ist.
Als Beth fühlt, wie der HiAce wieder auf die Autobahn biegt, bleibt sie so still liegen, wie sie kann. Ihr Körper ist zerdellt wie fauliges Obst, ihre Kehle brennt. Sie hat eine Beule am Kopf, ganz oben links, und all ihre Muskeln schreien. Hektisch geht sie alle Möglichkeiten durch, wie sie diese Situation navigieren soll – denn egal wie, letztendlich wird sie entdeckt werden, und was dann?
Es ist eine Erleichterung, dass die Antwort auf diese Frage schnell kommt. Nach nur wenigen Minuten entdeckt die Fahrerin Beth im Rückspiegel und flippt berechtigterweise komplett aus. Schriller Lärm erfüllt den Van, abgehackte Worte, die in voller Lautstärke geschrien werden, wa zur verschw wer ah wie bis du, bis Beth sich zu erkennen gibt, die Decke zurückschlägt und die Hände hebt, bitte, ist schon ok, hab keine Angst, aber die Fahrerin ist schon komplett panisch.
Der Van schleudert wild umher, rutscht von einer Fahrbahn auf die andere, bis er komplett von der Straße abkommt. Alle Platten und Schrauben ächzen, als die Räder über den gesprungenen, unebenen Boden holpern. Beth wird hin und her geschleudert und muss die Matratze loslassen. Schließlich wird sie ganz abgeschüttelt und landet mit einem dumpfen Knall auf dem Boden. Die Fahrerin schreit und der Van macht noch eine Kurve, dieses Mal so heftig, dass Beth gegen die Küche geschleudert wird, wobei sie sich den Kopf an einer Schublade stößt – und dann fällt sie wieder zu Boden, als der Van weiter schlittert. Kurz balanciert er nur auf zwei Rädern, bis er sich irgendwie wieder aufrichtet und endlich ruckelnd zum Stehen kommt.
Ohne eine Sekunde zu verlieren, zieht die Fahrerin ruckartig die Handbremse an, zerrt die Schlüssel aus dem Zündschloss und stürzt sich in die Nacht hinaus. Beth bleibt hinten allein zurück. „Ach du Scheiße“, murmelt sie und hievt sich in eine sitzende Position. Ihr linkes Auge pulsiert, als würde es gleich explodieren und irgendwas in ihrer Schulter stimmt ganz und gar nicht. „Au.“ Sie drückt gegen ihre Augenbraue und als sie sie wegzieht, sind ihre Finger blutverschmiert. „Na toll. Perfekt.“
Sie späht aus dem Fenster. Der Van ist in einer gefährlichen Position zum Stehen gekommen. Die Motorhaube ragt in die nach Norden führende Spur hinaus, während das Heck im Gebüsch vergraben ist. Die Fahrerin ist nicht weit; Beth kann sie irgendwo in der Dunkelheit hysterisch schreien hören. Es ist nur hau ab, verschwinde aus meinem Van, verpiss dich, lass mich in Ruhe, immer und immer wieder. Sie muss den Mund halten, oder sie wird noch Aufmerksamkeit auf sich ziehen.
Beth kommt auf die Beine, indem sie sich an der Küchenanrichte hochzieht. Blut sickert von ihrer Schläfe bis zu ihrem Kinn herunter. Sie wischt es weg und streicht ihre Haare zurück. Ihr Kopf wechselt so nahtlos in den Selbsterhaltungsmodus, dass sie kaum merkt, dass es passiert. Ihr Körper ist es gewohnt, die nötigen Anpassungen zu tätigen – ihr Gehirn hat den Wechsel perfektioniert.
Sie richtet sich auf, schiebt die Tür auf und tritt auf die Straße.
Ein gutes Stück entfernt tritt die Fahrerin – klapperdürr, kurze Haare, riesiges T-Shirt – nervös von einem Fuß auf den anderen und hält irgendetwas in die Höhe. „Bleib, wo du bist“, quietscht sie. „Ich bin bewaffnet.“
Lügnerin, denkt sich Beth, aber sie beschließt, den Bluff nicht auffliegen zu lassen. Stattdessen spielt sie mit und streckt die Hände gen Himmel, während sie nach den richtigen Worten sucht. Nicht die Wahrheit. Alles außer der Wahrheit.
„Tut mir leid“, ruft sie – oder versucht es zumindest. Ihr Hals und ihre Kehle schmerzen so heftig, dass es schwer ist, ihre Stimme ruhig zu halten. Sie schluckt und es brennt wie Säure. „Bitte, ich brauche Hilfe.“
Die Frau gibt nicht nach. Jeder Muskel in ihrem Körper ist angespannt und bereit zum Angriff. Aber sie ist keine Kämpferin, das sieht Beth sofort. Sie zittert. Und das Ding in ihrer Hand ist viel zu klein, um eine Waffe zu sein. Es ist ein Schlüssel. Beth betrachtet ihn hungrig.
„Ich bin nicht gefährlich“, fährt sie fort. „Versprochen. Ich habe versucht abzuhauen, ich habe Hilfe gebraucht, und da habe ich deinen Van gesehen. Ich wollte dir keinen Schreck einjagen, es war ein Versehen. Bitte, du musst mir glauben.“
Die Fahrerin sieht sich um, und hofft offensichtlich darauf, irgendein anderes Auto oder einen Laster zu sehen, einen anderen Menschen, dem sie diese unmögliche Situation aufhalsen kann – und wer kann es ihr verdenken. Beth könnte sonst wer sein: eine Drogenabhängige, eine Verbrecherin auf der Flucht, eine weggelaufene Psychiatriepatientin. Sie sieht zu, wie sich die Frau auf der Stelle dreht, die Hände auf das Gesicht gedrückt. Wer sie auch ist, sie kann offensichtlich nicht gut mit Krisen umgehen und will einfach nur, dass das alles weggeht – aber sie ist auch hin- und hergerissen. Kämpft mit sich. Ein Teil von ihr möchte helfen.
Kurzentschlossen lässt Beth sich auf den Boden fallen, als hätten ihre Knochen sich in Luft aufgelöst. Sie denkt an zu Hause und schon kommen die Tränen. Die Fahrerin tritt näher und Beth weint noch heftiger. Na los, denkt sie, komm schon, nur noch ein kleines Stück. Die Frau kommt immer näher, der Schlüssel glitzert in ihrer Hand. Es bräuchte nicht viel, sie müsste nur einmal fest schubsen, schnell nach dem Schlüssel greifen, und in wenigen Sekunden könnte sie weg sein.
Aber dann bleibt die Fahrerin genau außerhalb ihrer Reichweite stehen. Sie verschränkt die Arme und hockt sich hin. „Hey“, sagt sie sanft und begibt sich in Beths Sichtfeld. „Nicht weinen.“ Ihre Stimme ist plötzlich ganz mild, die Hysterie wurde von etwas Kontrollierterem abgelöst. „Wie heißt du?“
Beth hebt den Kopf, dieser Wandel macht sie misstrauisch. Ihr Name … Sie benutzt mittlerweile so viele, dass es schwer ist, sie alle im Kopf zu halten. „Lily“, erwidert sie, indem sie irgendeinen aus dem Kopf zieht wie ein Kaninchen aus einem Zylinder.
„Lily“, wiederholt die Frau und als sie ihrem Blick begegnet, spiegelt sich auf ihrem Gesicht eine Art tiefer Trauer. „Ok. In Ordnung. Ich glaube dir. Ich kann dir helfen.“ Sie steht wieder auf, steckt den Schlüssel in die Hosentasche und streckt die Hand aus. „Komm ins Auto. Ich fahre dich ins Krankenhaus.“
Beth dreht sich der Magen um. Das ist der letzte Ort, an dem sie sein sollte. „Oh. Nein. Das ist sehr lieb von dir, aber mir geht's gut.“
„Dann zur Polizei.“
„Wirklich, das geht schon.“
„Aber du hast gesagt, du brauchst Hilfe.“
Beth weiß nicht, was sie darauf sagen soll. Was für eine Ausrede kann sie hier nur liefern?
Die Fahrerin runzelt die Stirn. „Ok, aber irgendwo hin muss ich dich bringen. Hier kannst du nicht bleiben.“
Beth starrt in die Dunkelheit hinaus. Es stimmt, das kann sie nicht. Und den Van zu stehlen würde ihr langfristig auch nicht helfen. Ok, Planänderung.
„Kann ich … mit dir kommen?“, fragt sie. „Einfach dahin, wo du sowieso hinfährst. Ich mache dir keinen Ärger, versprochen. Ich muss mich nur irgendwo richten und sammeln.“
Die Fahrerin legt den Kopf schief und betrachtet Beth mit einer Mischung aus Misstrauen und Mitleid – und noch etwas anderem, was Beth nicht genau identifizieren kann.
„Bitte. Nur für eine Nacht. Ich kann nicht mehr klar denken. Ich muss mich ausruhen.“
Darüber denkt die Frau kurz nach. „Na gut“, sagt sie schließlich. „Nur für die Nacht. Morgen früh entscheiden wir, wie wir weitermachen.“
Beth wischt sich mit der Hand über die Augen. „Danke.“
„Komm. Wir können im Auto weiterreden.“
Beth lässt sich auf die Beine ziehen und in den Van begleiten. Sicher auf dem Beifahrersitz angekommen, schnallt sie sich an und wappnet sich für eine Fragenlawine, für jede mögliche Variante von was ist nur mit dir passiert? Wieder zieht sie in Erwägung, einfach mit der Wahrheit zu antworten. Aber das könnte sie nicht, selbst wenn sie es wollte. Weil die wahre Frage nicht ist, was mit ihr passiert ist, sondern wer.
Kapitel Drei
Wyatt
Wyatt Cleary ist krank.
Nur eine Virusinfektion, hat der Hausarzt gesagt. Wenn er sich ausruht und reichlich Flüssigkeit zu sich nimmt, ist er bald wieder ganz der Alte. Aber das ist jetzt schon drei Wochen her und er liegt immer noch mit Kopfschmerzen, Fieber und rasendem Herzen auf dem Sofa. Und das ist nicht alles, seine Augen brennen, der Appetit ist ihm vergangen und egal, wie erschöpft er ist, er kann nicht schlafen.
Das Gute an der Sache ist, dass er keine Schulaufgaben machen muss. Dad sagt, dass das egal ist, weil er jetzt fünfzehn ist und schon alles gelernt hat, was er braucht, und er ja sowieso für den Familienbetrieb arbeiten soll. Vollkommen egal, dass Wyatt sich überhaupt nicht für Gärtnerei oder auch nur Pflanzen interessiert, das ist nun mal seine Zukunft – und es ist ja nicht so, als hätte er eine andere Möglichkeit. Mit Filme gucken kann man kein Geld verdienen, sagt Dad immer, vor allem nicht mit der Sorte Filme, die du so magst. Das stimmt natürlich. Aber im Moment kann Wyatt dank seiner Grippe – oder was es auch ist – so viele sehen, wie er will.
Gerade ist er zum Beispiel tief in einem seiner Lieblingsfilme versunken, ein absoluter Klassiker. Ein Junge und zwei Mädchen sind auf einem Roadtrip; die kurvige Autobahn führt sie direkt ins wilde Unbekannte. Wyatt liegt auf der Seite, sein Blick klebt am Bildschirm, er gibt sich nur zu gern dem Sog der Geschichte hin …
Poltern. Schlurfen. Pochen.
Er reagiert nicht sofort. Mittlerweile hat er sich an Die Geräusche gewöhnt. Es fühlt sich an, als würden die Hauswände schon seit ewigen Zeiten mit ihm reden. Aber wenn er genau darüber nachdenkt, kann er sich wohl an den genauen Moment erinnern, in dem es angefangen hat.
Damals war er elf. Ein Sonntag im Sommer, es war zu heiß zum Spielen oder sogar, um zum Strand zu gehen, also sahen Lucas und er fern. Oberkörperfrei, Rollläden unten, den Ventilator auf der höchsten Stufe, genau wie sie es mochten. Dad war nicht da; natürlich war er nicht weit weg, arbeitete irgendwo im Garten, jätete Unkraut und schwitzte in der brennend heißen Sonne (Man darf sich vom Wetter nicht unterkriegen lassen, deinen Pflichten ist das Wetter egal). Aber zumindest war er weit genug weg, dass er sie nicht genau im Blick hatte. Hätte er das, hätten sie niemals einen von Lucas' Filmen angeschaut.
Aber so wie es kam, taten sie das. Lucas lag auf dem Sofa, die Füße auf dem Couchtisch, Wyatt auf dem Boden und hatte die Knie angezogen. Und da wurde Wyatt von seltsamen Geräuschen abgelenkt; gedämpftes Poltern und Schleifen, wie das Trippeln von Ratten in einem Karton. Er setzte sich gerade hin und suchte den Raum ab, aber abgesehen von ihm und Lucas war da nichts.
Er wandte sich wieder dem Fernseher zu, aber wenige Sekunden später hörte er es wieder: schlurf-krach-klopf. Dieses Mal wirbelte er um die eigene Achse, blickte auf den Boden, die Decke, die Fenster. Die Geräusche waren genau hinter ihm, davon war er überzeugt.
„Was ist denn mit dir?“, fragte Lucas. „Warum kannst du nicht einfach still sitzen?“
Klopf-klopf-schlurf.
„Hast du das gehört?“, fragte Wyatt, statt zu antworten.
„Nö.“
Er stand auf und schlich auf das Bücherregal zu. „Da bewegt sich was.“
„Ein Opossum auf dem Dachboden“, sagte Lucas gelangweilt, den Blick immer noch auf den Bildschirm geheftet. „Oder 'ne Schlange. Dad hat da oben neulich eine Braunschlange gefunden.“
Wyatt strich mit den Fingern über die verstaubten Regale und berührte nacheinander alle Bilderrahmen: eins, zwei, drei, vier. Manchmal half das, wenn sich Sachen falsch anfühlten.
Rumms.
Wow. Dieses Mal hatte er es in seinem Brustkorb und seinen Fußsohlen spüren können. Wie konnte Lucas das denn nicht hören? Es klang überhaupt nicht wie ein Tier. Er legte die Hand an die Wand links neben dem Regal. Sie fühlte sich warm an. Er ging noch einen Schritt darauf zu und drückte ein Ohr gegen die Tapete. Der Gips summte wie ein Bienenstock. Und je länger er zuhörte, desto mehr klang das Summen wie Flüstern, Seufzen und Murmeln, oder wie das Knistern von Stoff, zarte Fasern, die durch Fingerspitzen fließen, Faden um Faden um Faden –
„Wyatt.“ Lucas starrte ihn vom Sofa aus an. „Alles in Ordnung, Kleiner?“
Wyatt trat erschreckt von der Wand zurück. „Ja.“
„Was ist los?“
„Nichts.“
„Hunger?“
„Nein.“
„Durst?“
„Ne.“
„Dann setz dich.“
Das war das erste Mal gewesen, aber es sollte nicht das letzte bleiben.
Und jetzt sind sie wieder da. Er versucht, Die Geräusche so gut es geht auszublenden. Er fläzt sich auf das Sofa und verliert sich, genau wie damals, in dem Film. Auf dem Bildschirm blicken die drei Reisenden in einen gigantischen Krater, vollkommen ahnungslos, welcher Horror sie tief im Outback erwartet.
Langweilig, denkt er, und spult bis zum besten Teil vor. Die ganze Vorgeschichte interessiert ihn nicht, das Vorgeplänkel ist ihm egal. Er mag es, wenn die Action losgeht. Er mag es, wenn sie wegrennen.
Gefällt trailinghappytales und weiteren
pheebsinwonderland Es ist zwar erst der erste Tag des Big Lap, aber ich habe mich jetzt schon Hals über Kopf in Westaustralien verliebt. Ich bin bei Sonnenaufgang in Perth losgefahren und 200km nach Norden auf dem Indian Ocean Drive nach Cervantes gefahren – mit ein paar kleinen Zwischenstopps. Die Landschaft war krass: zuerst so viele unterschiedliche Bäume und dann die ganzen gigantischen Felsen (wie Styroporfetzen) und die ganzen riesigen Sanddünen, die mitten im Nichts auftauchen, wie Blasen auf einem Pizzateig. Ich habe einen kleinen Umweg gemacht, um den Nambung Nationalpark zu sehen (eine Landschaft mit Kalksteinsäulen, „Pinnacles“, die anscheinend vor 25.000 Jahren entstanden sind), und er war vollkommen atemberaubend und irgendwie unheimlich, als wäre man auf dem Mars. Ich habe in Cervantes zu Mittag gegessen (shout-out an das tolle kleine Meeresfrüchterestaurant beim Strand, dessen Namen ich mir leider nicht gemerkt habe) und dann war ich auch schon zurück auf der Straße, für die nächsten 300km. Ich habe noch einige Umwege über unbefestigte Wege zu wunderschönen winzigen Stränden gemacht (Green Head, ich rede mit dir!)
Und jetzt beende ich den Tag mit einem im Van gekochten Abendessen auf dem total entzückenden #PlainsRanchCampingplatz genau hinter Geraldton und möchte einfach nur Dankbarkeit für einen fantastischen Start ausstrahlen. Kein Job, keine Verantwortung, kein Stress – nur ich, der Van und die große weite Welt. Man muss #vanlife einfach lieben!
(Bildbeschreibungen: Acht verschiedene Bilder von der Strecke zwischen Perth und Cervantes. 1. Die Straße, die aus Perth hinausführt, durch die Windschutzscheibe eines Campingwagens fotografiert. 2. Eine Ansammlung stummeliger, buschiger Bäume, die aussehen wie die Trolle in Die Eiskönigin. 3. Eine riesige weiße Sanddüne, die sich aus dem grünen Gestrüpp erhebt, als hätte Gott sein Eis fallen lassen. 4. Ein Strand voll mit Seetang, auf dem man die Silhouette einer Frau sieht, die durch das Nachmittagslicht unwahrscheinlich groß aussieht. 5. Die Kalksteinsäulen in der Pinnacles Wüste, von hinten durch einen Sonnenuntergang angestrahlt. 6.&7. Eine Frau schafft es, einem zögerlichen Pferd einen Apfel zu füttern und freut sich dann übertrieben. 8. Ein Campingwagen bei Nacht, der neben einer Pferdekoppel steht und von innen beleuchtet ist.)
#roadtrippin #cervantes #yanchepnationalpark #pinnaclesdesert #wanderlust #hungrigespferd #issdenapfelnichtmich
Alle 32 Kommentare anzeigen
turnaroundthesum66 Wie cool! Wie toll ist bitte Westaustralien?
paperscissorsmountain Karijini! Da musst du unbedingt hin, es ist UNGLAUBLICH!
goodnightpetergraham Wenn du nach Kalbarri weiterfährst, ist da ein tolles Café am Wasser, direkt gegenüber von der Gedenkstätte. Und verpass nicht Hutt Lagoon, der liegt auf dem Weg!
ginabobeena Die Wildblumen im Lesueur Nationalpark sind klasse. Und die Seelöwen in Jurien Bay auch.
lonewanderer66 Deine Fotos sind wirklich schön, verkaufst du Drucke davon?
16. Mai
Kapitel Vier
Katy
Ich öffne die Augen und bin sofort vom Licht geblendet. Ich zucke zusammen – mein Kopf ist immer noch voll von Scheinwerfern und Asphalt, das Nachhallen eines Traums, der schnell verschwindet – aber es ist nur die Sonne, die erschreckend hell und schon warm durch meine Windschutzscheibe scheint. Ich muss lange geschlafen haben.
Geräusche tauchen am Rand meines Bewusstseins auf: das Klirren von Gläsern, ein weinendes Baby und ganz leise eine fröhliche, kindliche Melodie wie aus einer Musikbox. Ich bedecke mein Gesicht mit dem Arm und drehe mich auf die andere Seite. Mein Magen rumort, mein Kopf pocht. Ich lege mir leicht die Hand aufs Gesicht – es fühlt sich klamm an. Ich muss an Stressbälle und feuchten Ton denken und frage mich, ob meine Finger kleine Dellen in meiner Haut hinterlassen haben.
Und dann fällt es mir wieder ein. Letzte Nacht. Lily.
Die Luft im Van fühlt sich plötzlich elektrisch aufgeladen an, dicker als sonst, und von einem ungewohnten Geruch erfüllt. Ich blicke auf die Trennwand und horche nach Geräuschen aus der Fahrerkabine. Schläft sie noch? Wie viel Uhr ist es? Ich setze mich auf und greife nach meinem Handy. 11:41. Huch. Ich schlafe eigentlich nie so lang. Ich werfe die Decke beiseite und sammele das T-Shirt von gestern vom Boden auf. Ich schiebe einen Vorhang zur Seite und schaue aus dem Fenster auf weiße Zäune, terrakottafarbene Koppeln und Pferde, die sich unter dem endlosen blauen Himmel tummeln. Dahinter steht ein langes, einstöckiges Gebäude wie eine mexikanische Hazienda: weiße Stuckwände, ein rotes Ziegeldach und ein großes Schild mit der Aufschrift PLAINS RANCH CAMPGROUND. Die Sonne nähert sich ihrem Zenit.
Ich drehe mich wieder um und betrachte das Chaos im Van. Meine Klamotten sind überall verstreut, die Handtücher sind feucht und voll mit Sand, und der Boden ist übersät mit Belegen, Einkaufszetteln, Visitenkarten und zerknitterten Touristenflyern. Das muss alles bei dem Chaos gestern Nacht aus einer der Schubladen gefallen sein. Und es sind auch Flecken auf dem Boden, Blut und Dreck, weitere Belege für Lilys überraschende Ankunft.
Ich stehe auf und spähe durch das Fenster in der Trennwand. Eigentlich erwarte ich, meinen blinden Passagier auf dem Beifahrersitz schlafen zu sehen, aber abgesehen von dem Kissen und der Decke, die ich ihr gegeben habe, ist die Fahrerkabine leer. Das Handtuch, die Zahnpasta und die Klamotten sind weg, was darauf hindeutet, dass sie duschen gegangen ist – aber wer weiß das schon? Während ich wieder aus dem Fenster gucke und den Campingplatz betrachte, wird mir klar, dass ich keine Ahnung habe, wo sie hin ist, was ihr ähnlich sehen würde. Außer ihrem Namen weiß ich rein gar nichts über sie.
Als wir letzte Nacht wieder im Van angekommen und losgefahren sind, ist Lily quasi komplett heruntergefahren. Ihre Zähne haben geklappert und sie hat gezittert wie Espenlaub, also habe ich die Heizung angemacht und ihr einen Pullover gegeben. Und Sekunden später war sie dann auch schon tief und fest eingeschlafen. Sie war in ihren Zwanzigern, beschloss ich, Anfang oder Mitte. Hübsch aber nicht schön, klein, aber nicht zierlich. Gewelltes, schulterlanges Haar, Sommersprossen auf den Schultern, Klavierhände, angekaute Nägel. Die salzige Haut einer erfahrenen Reisenden. Im rechten Ohr hatte sie drei silberne Ohrringe und um ihr linkes Handgelenk war ein zartes Armband aus grünem Seeglas. Wäre sie nicht in diesem schrecklichen Zustand gewesen, hätte sie ausgesehen wie jede andere Vanliferin auf Reisen.
Aber ihr aschgraues Baumwollshirt war schmutzig, übersät mit Staubschlieren und undefinierbaren Flecken und an einer Seite war die Naht bis zur Hüfte aufgerissen. Sie war barfuß und ihre Füße waren übersät mit Blasen und schwarz vor Dreck. Keine Tasche, kein Geldbeutel, keine Schlüssel, keine Jacke. Ihre Stirn blutete, ihre Knie waren zerkratzt und sie hatte einen Ring aus violetten Blutergüssen an ihrem Nacken und ihren Schlüsselbeinen. Sie sah wild aus, wie eine Kreatur, die frisch aus der Hölle entsprungen war – aber sie hatte auch etwas Engelhaftes an sich.
Tat ich das richtige? Ich wusste gar nichts darüber, wer sie war, oder wo sie herkam, und ich war wohl kaum die Richtige, um für irgendwen die Krankenschwester zu spielen; ich konnte kaum für mich selbst sorgen. Aber diese Fremde war verletzt und sie war allein. Und plötzlich war es nicht Lily, die neben mir schlief, sondern Phoebe, verloren und verletzt, und schrecklich hilfsbedürftig, und ich wusste, dass es egal war, ob ich hiermit die richtige oder die falsche Entscheidung traf. Ich konnte sie nicht zurücklassen. Ich weigerte mich.
Etwa eine Stunde später kamen wir bei der Plains Ranch an, und, da es mir gelungen war, auf der Strecke noch einen nachträglichen Check-In zu organisieren, steuerte ich den Van durch die endlosen dunklen Reihen der Wagen und Zelte bis zu meinem Stellplatz. Mein erster Gedanke war es, mich um Lilys Wunden zu kümmern, aber sie wachte auch nach einigen sanften Versuchen nicht auf. Also schnappte ich mir eine Decke und ein Kissen von meinem Bett und steckte sie so gut es ging um sie herum. Dann legte ich ein sauberes Handtuch, Duschgel und Zahnpasta auf den Fahrersitz, damit sie sie am Morgen finden konnte, zusammen mit einem Unterhemd und einer kurzen Hose, die ich aus einer Schublade gezogen hatte. Dann schloss ich alles ab und ging selbst schlafen.
Jetzt fühlt sich das ganze an wie ein Traum: irgendwie verschwommen und furchtbar unwahrscheinlich. Außerdem unpraktisch und mehr als nur ein bisschen gruselig. Meine guten Absichten in allen Ehren, aber ich habe das Gefühl, dass ich schon wieder einen riesigen Fehler gemacht habe.
Ich sehe durch das Fenster zu, wie die anderen Camper draußen umherlaufen, gerade ankommen oder wieder alles zusammen packen, wie sie Geschirr waschen und Mittagessen kochen. Unter der Markise eines Wohnwagens fegt ein grauer Nomade Dreck von einer Matte. Weiter rechts feuert ein Mann mit Strohhut den Grill an und ein Stück dahinter balanciert eine Familie Teller mit Sandwiches auf ihren Knien. Die Luft ist von köstlichen Düften erfüllt und mein Magen beginnt zu knurren. Und wenn sie noch hier ist, wird auch Lily bald essen müssen.
Ich will einen Blick in meine Küchenschränke werfen, aber alle Oberflächen sind so vollgestellt, dass ich gar nicht ans Kochen denken kann. Wie kann denn nach nur 36 Stunden alles schon so chaotisch sein? Das war nicht der Plan.
Ich fange mit dem Bett an, schüttele die Decke aus, streiche die Laken glatt und lege die Kissen zurück an ihren Platz. Dann sammele ich den Müll vom Boden auf, hebe die Handtücher und die Kleidung auf und lege sie in eine Wäschetasche. Ich klopfe den Teppich aus, fege den Sand aus dem Wagen, wische die Arbeitsfläche ab und putze die Fenster. Ich werfe einen Blick in die Küchenschränke und mache mir eine Liste von allen Dingen, die ich noch nicht habe, und denen, die ich bald wieder auffüllen muss.
Und schließlich trenne ich Belege und Flyer vom restlichen Müll und lege sie auf einen ordentlichen Stapel – als ich das tue, rutscht mir eine Karte aus der Hand und trudelt zu Boden. Ich beuge mich herunter, um sie aufzuheben. Es ist eine Visitenkarte, von Detective Dust, dem leitenden Ermittler im Fall von Phoebes Verschwinden. Ein großer Mann mit einer schroffen Stimme und einem Kopf wie eine Kartoffel. Ich fühle die raue Oberfläche seiner Hand, als er mir die Karte in die Hand gedrückt hat: Wenn Sie irgendetwas brauchen, melden Sie sich gerne. Worte, die vollkommen bedeutungslos waren, sobald der Fall abgeschlossen war.
Ich drehe die Karte um. Sie ist schon ganz abgegriffen und die Nummer darauf ist verblasst, aber noch lesbar. Ich hatte eigentlich noch nicht vor, mich beim ihm zu melden, wollte es vielleicht gar nicht tun. Aber wie dieses kleine weiße Viereck in genau diesem Augenblick zu Boden gefallen ist, fühlt sich an wie ein Zeichen, wie eine Tarotkarte, die sich aus dem Stapel löst. Ich sollte ihn zumindest wissen lassen, dass ich hier bin.
Ich wähle die Nummer und nach nur drei Mal Klingeln wird der Anruf angenommen. „Hier spricht Dust.“ Seine Stimme klingt erstaunlich gut gelaunt. Aber dann rauscht die Verbindung und für einen Moment ist er weg. „Hallo?“, frage ich und umklammere das Handy mit beiden Händen. „Hallo, können Sie mich hören?“
„… leider gerade nicht ans Telefon gehen, aber wenn Sie mir Ihren Namen und Ihre Telefonnummer hinterlassen …“
Frustration lodert in mir auf, kurz, aber heftig. Ich warte auf das Piepen. „Detective, hier ist Katy Sweeney. Ähm. Ich hoffe, dass Sie mich hören können, die Verbindung ist nicht so stabil– na ja, ich wollte Ihnen nur erzählen, dass ich hier in Westaustralien bin, und dass es ja mittlerweile über ein Jahr her ist, also … Also wenn Sie mich zurückrufen könnten, wäre das toll. Und … das war's eigentlich. Ok, tschüss.“
Ich lege auf, werfe mein Handy auf das Bett und betrachte meinen frisch geputzten Van melancholisch. Alles ist wieder an seinem Platz, die Kissen sind aufgeschüttelt und die gemusterte Decke ist kunstvoll drapiert. Im Küchenbereich glänzen die Armaturen, das Gewürzregal ist perfekt sortiert und jedes einzelne Blatt meiner Plastikpflanze ist von Staub befreit. Ich habe sogar die Lichterkette abgewischt. Alles ist wieder genau so, wie es war, so, wie es Phoebe gefallen hätte. Ich kann mich entspannen.
Aber ich tue es nicht. Denn auch wenn der Van aussieht wie Phoebes, er ist es nicht. Ich habe versucht ihren Stil und ihren Geschmack zu kopieren, weil ich gehofft habe, dass das helfen würde. Aber das tut es nicht. Nichts kann die Tatsache ändern, dass sie weg ist. Und egal wie sehr ich es mir wünsche, ich kann sie nicht durch Staubwischen und Polieren zurückbringen.
Ich setze mich an den Rand des Bettes und fingere an meiner Nagelhaut herum. Meine Hände sind eklig, die Nägel fast so dreckig und trocken wie Lilys. Meine Knöchel sind knorrig wie die Astlöcher an einem Baum. Phoebes Hände waren viel schöner – auch wenn sie sie gehasst hatte. Sie sind dick und stummelig, sagte sie immer. Sie sehen aus wie Pfoten. Ich fand das lustig. Wenn deine Pfoten sind, erwiderte ich, sind meine Klauen. Das brachte sie dann zum Lachen.
Die Erinnerung an Phoebes Kichern ist so unerwartet lebhaft, dass ich unwillkürlich ein Geräusch ausstoße: halb Lachen, halb Schluchzen. Ich schließe die Augen und versuche verzweifelt, das Lächeln festzuhalten, aber es sinkt schon außerhalb meiner Reichweite, zurück an den Ort, an dem mein Hirn diese Dinge versteckt. Und dann ist es weg. Ich kann sie nicht mehr hören.
Trauer trifft mich wie ein Schlag kaltes Wasser. Manchmal passiert mir das, dass es mich unvorbereitet trifft und wieder wehtut, als wäre die Wunde ganz frisch, wenn ich es am wenigsten erwarte. Es hält nur für ein paar Sekunden an, aber in diesem Augenblick fühlt es sich endlos an, als wäre ich unter einer Eisschicht gefangen.
Ich entsperre mein Handy und rufe Phoebes Instagram-Account auf.
pheebsinwonderland. 477 posts, 2,837 Follower, 692 gefolgt. Solo female traveler. Nur Ehrfurcht, Begeisterung und krasse Abenteuer. Bald kommt mein Blog!
Und da ist sie: karamellfarbenes Haar, dunkelbraune Augen und geschwungene Lippen, die zu einem atemberaubenden Lächeln verzogen sind. Auf einem Bild nach dem anderen. Mein Blick wandert über das Profil und ich fühle mich sofort besser.
Der Account ist hell und schön. Jedes kleine Quadrat ist ein Fenster in eine andere Welt, und Phoebe ist die Sonne. Ich scrolle zu dem ersten Bild von ihrer Reise und sauge es gierig auf. Mit ihrer wunderschön gebräunten Haut und ihrem gelben Lieblingsbikini sieht sie aus wie eine Sternschnuppe, die auf die Erde gefallen ist. Ich glaube, sie würde wollen, dass man sie genau so in Erinnerung behält: frei und doch geerdet, immer im Bewegung. Die Bildbeschreibung liest sich wie ein Gedicht.
Auf dem nächsten Bild sieht man eine Karte von ihrer geplanten Reise – ein vollständiger Rundweg, einmal um den ganzen Kontinent. Die Reise verläuft hauptsächlich auf dem Highway 1, ist etwa 14.500 Kilometer lang und verläuft durch fast jedes Bundesland und ihre Hauptstädte. Auf den nächsten Seiten des Posts werden die einzelnen Etappen beschrieben. Phoebe hatte beschlossen, mit dem abwechslungsreichen 1200-Kilometer langen Abschnitt zwischen Perth und Ningaloo anzufangen, der auch als Coral Coast bekannt ist. In ihrer Caption schreibt sie, dass diese Strecke alles zu bieten hat: wunderschöne Strände, Klippen und Schluchten, Farmen zum Übernachten, Meeresschutzgebiete und abwechslungsreiche Landschaften. Und anscheinend ist Perth auch die perfekte Stadt, um einen Van zu kaufen und ihn nach dem Trip wieder zu verkaufen, bevor man dann nach Indonesien fliegt. Diesen Post sehe ich mir nicht so genau an. Ich hasse es, vor Augen geführt zu bekommen, wie wenige ihrer Pläne sie tatsächlich in die Tat umsetzen konnte.
Und was ich auch nicht mag, sind die Kommentare. Unter jedem Post stehen eine Handvoll Bemerkungen von Lesern, irgendwelche Leute, die glaubten, sie würden sie kennen, einfach nur, weil sie das Reisen gemeinsam hatten. Wir Reisenden sind wie eine große glückliche Familie, hatte jemand unter einen ihrer Posts geschrieben. Ich würde am liebsten zurückschreiben und erklären, was das Wort „Familie“ eigentlich heißt. Nein, eigentlich wollte ich schreien. Jetzt vermeide ich es, sie zu lesen. Mir gefällt nicht, was sie mit meinem Herzen anstellen.
Ich gehe zum nächsten Foto, eins der vielen Bilder vom Sonnenuntergang, bei dem Phoebe von der Kamera weggedreht ist und auf die Explosion aus Licht und Farben zugeht. Ich strecke die Hand aus, um den Bildschirm zu berühren, fahre ihre Silhouette mit der Fingerspitze nach. Ein Knoten bildet sich in meinem Hals. Diese Posts waren lange sehr kostbar für mich. Sie sind meine letzte Verbindung zu ihr, den einzigen Anknüpfungspunkt an sie, den ich noch habe. Gleichzeitig hasse ich sie, weil sie den Grund für ihr Verschwinden zeigen: wäre sie nicht auf Reisen gegangen und in diese Welt des „Influencens“ hineingeraten, dann wäre sie jetzt noch hier. Aber das ist sie nicht. Und jetzt, wo stattdessen ich hier bin, und in ihren Fußstapfen wandele, ist dieser Instagram-Account noch einmal so viel mehr geworden. Er ist jetzt mein Anker und mein Ruder, meine Karte, mein Kompass. Er ist wichtiger denn je.
Ich starre die Bilder an und versuche, all diese winzigen Versionen von Phoebe dazu zu bringen, zum Leben zu erwachen und mich anzuschauen. Aber in fast allen Fotos hat sie der Kamera den Rücken zugedreht, oder ist in Schatten getaucht, oder steht im Gegenlicht der Sonne. Nicht, weil sie unsicher oder schüchtern gewesen wäre – so hätte sie niemand beschrieben – sondern weil das ihr persönlicher Stil war. Sie wollte die Szenerie im Vordergrund stehen lassen. Sie sagte, das sei ihr Unterscheidungsmerkmal; das, was sie von der Masse all der anderen Influencerinnen mit ihren Filtern und ihrem übertriebenen Make-up abhob. Sie wollte nicht, dass ihr Aussehen im Vordergrund stand. Und das tut es auch nicht – aber man kann ihre Energie in den Bildern fühlen, unbestreitbar kraftvoll. Selbst, wenn sie versuchte, nicht im Mittelpunkt zu stehen, konnte sie es einfach nicht verhindern.
Aber trotz der Schönheit der Bilder sehe ich auch die Dunkelheit in ihnen. Bis ich sie finde, werden Phoebes Fotos Porträts von Trennung und Isolierung bleiben, und eine unbestimmte Gefahr lauert irgendwo abseits des Bildes.
Die Beschreibungen sind aber immer fröhlich. Ich versuche, die Worte aus ihrem Plains Ranch Post mit meiner eigenen Erfahrung zu verbinden. Dieselbe Abfahrt aus Perth, das Erwerben eines so ähnlichen Vans, wie ich ihn nur finden konnte. Dieselbe Strecke, dieselbe Landschaft, derselbe Ort für eine Mittagspause. Aber die beiden Erfahrungen passen nicht so gut zusammen, wie ich es erwartet hatte. Ich bin zwar gerade erst losgefahren, aber bisher fühlt es sich nicht besonders friedlich oder befreiend an, so ganz alleine durch die weite Welt zu fahren, und die Landschaft ist nur insofern atemberaubend, als ich das Gefühl habe, dass ich keine Luft kriege. Ich sehe den endlosen Himmel an, die Prärie, die Straße, und dort, wo eigentlich Aufregung sein sollte, finde ich nur eine grimmige Entschlossenheit. Phoebe ist am Leben, das weiß ich genau. Und ich werde sie finden, selbst wenn es mich umbringt.
Mein Handy vibriert, als ich eine Nachricht von Mum kriege.
Gehts dir gut?
Ich verdrehe die Augen. Ich habe ihr gestern erst geschrieben. Aber dann tut es mir leid, dass sie sich wegen mir Sorgen macht, denn natürlich tut sie das. Ich schreibe eine flüchtige Antwort – alles gut, nicht viel zu erzählen, hab dich lieb – und kehre zurück zu Instagram.
Ich will unbedingt verstehen, wie es Phoebe ging, als sie hier war. Ich will den gleichen Weg gehen wie sie, ihre Fußstapfen ausfüllen, die Welt durch ihre Augen sehen … wie sonst soll ich Antworten kriegen? Jetzt, wo alle anderen aufgegeben haben, und die Suche nach ihr für beendet erklärt wurde, was soll ich da anderes tun, als selbst zu suchen? Soll ich etwa einfach zu Hause sitzen und hoffen, dass neue Beweise auftauchen? Beten, dass sich ein neuer Zeuge meldet? Darauf vertrauen, dass das alles „schon werden wird“? Manchmal gibt es keine Antworten, Liebling, sagt meine Mutter gerne. Manchmal müssen wir einfach loslassen. Aber das will ich nicht akzeptieren. Ich kann es nicht akzeptieren.
Ich muss an die Camper denken, die draußen ihrem normalen Alltag nachgehen: wie sie essen, trinken, duschen, Haare verlieren, Bakterien verbreiten, mit ihren Nachbarn plaudern, ihre Handys benutzen, ihr Geld ausgeben, und auf allem, was sie anfassen, ihre Fingerabdrücke hinterlassen. Ich blicke auf den Boden und weiß, dass ich zwar aufgeräumt und geputzt habe, aber dass immer noch Reste von Lilys Blut am Vinyl kleben. Der ganze Van ist schon voll von ihr – ihren Haaren, ihrer Haut, ihrem Geruch, ihrem Speichel – und ich weiß, dass ich mit meinem Instinkt richtig liege.
Menschen verschwinden nicht einfach. Sie können sich nicht „spurlos“ „in Luft auflösen“. Alle hinterlassen Spuren; man muss sie nur finden. Und wenn man nichts finden kann, dann nur, weil man nicht am richtigen Ort sucht.
Kapitel Fünf
Beth
In der hintersten der sechs etwas zwielichtig wirkenden Duschkabinen steht Beth mit geschlossenen Augen und lässt sich das Wasser, das so heiß ist, dass es ihre Haut rosa färbt, auf den Schädel prasseln.
Ihr tut der ganze Körper weh. Jeder Muskel ist so angespannt und empfindlich, dass sie sich kaum bewegen kann. Sie zuckt zusammen, als das Wasser über den Schnitt an ihrer Stirn, ihren gequetschten Hals und ihre zerschrammten Knie fließt und sie zählt die Stellen, an denen ihr Körper aufgegangen ist wie Brot. Man sieht weniger Verletzungen, als sie erwartet hätte, vor allem um ihren Hals, aber irgendwie ist es auch nicht überraschend. Manche Menschen wissen genau, wie sie Schmerzen verursachen können, ohne Spuren zu hinterlassen, als wäre das etwas, was man in der Schule lernen kann.
Sie pumpt billige Seife aus dem Spender an der Wand und schrubbt damit heftig über ihre Haut, in dem Versuch, gefühlt tausende Schichten Sand und Dreck und Schweiß abzuwaschen. Das Wasser zu ihren Füßen färbt sich orange-braun, ein Cocktail aus Schmutz. Sie denkt darüber nach, wo er herkommt, an all die unbekannten Oberflächen, die ihr Körper in den letzten Tagen und Wochen berührt hat. An all die Arten, auf die sie von ihnen verändert wurde, abgestoßen und in eine ganz neue Gestalt geformt wie eine Muschel am Strand.
Sie stützt sich mit den Händen an der Wand vor ihr ab und lässt den Kopf hängen. Trauer und Angst und Reue und Elend winden sich um ihr Inneres und drücken zu.
Ein anderer Tag, ein anderer Campingplatz.
Sie sitzt mit einem gebundenen Notizbuch auf dem Schoß am Pool und macht sich wie üblich Notizen. Die frühe Morgenluft war erfüllt von dem Surren von Reißverschlüssen, Türenschlagen und lautem Gelächter vom tiefen Ende des Pools. Drei Mädchen und fünf Jungs schütten einen Kasten Bier in sich hinein, schubsen sich gegenseitig ins Wasser und reißen in maximaler Lautstärke Witze. Aber Beth stört das nicht. Sie findet es tröstlich. Nostalgisch. Normale Leute, die in ihrem Urlaub normal Spaß haben.
Sie wendet sich wieder ihrem Tagebuch zu. Am Anfang war es nur ihre Art, den Überblick zu behalten, aber mittlerweile ist es so viel mehr: eine Geschichtensammlung, Beobachtungen, die sie in Flaschen füllt und verkorkt, um sie später zu genießen. Sie aufzuschreiben hilft ihr, sich zu beruhigen, und sie zu lesen heitert sie auf. Stellplatz vier, schreibt sie. Ehepaar ohne Kinder, verklemmt, beide karrierefokussiert? Sie klopft mit dem Stift gegen ihre Zähne und setzt die Spitze dann wieder aufs Papier auf. Sechs und sieben: Trip mittelalter Männer, Bier und Männergespräche, morgens früh weg, abends spät zurück.
Und so geht es weiter. Auf Stellplatz elf wird der Fluchtversuch eines Kleinkinds von einer Mutter, die noch den Schlaf in den Augen hat, unterbunden. Auf der vierzehn hängen zwei Teenager an ihren Handys herum, während sie müde ihr Müsli kauen. Die Gardinen in einem Apollo-Van zittern kurz und sind dann wieder ruhig.
Beth bemerkt, dass das Paar in dem Airstream noch nicht aufgewacht ist. Sie betrachtet die glänzende Karosserie, das gekurvte Dach und die Solarzellen. Angeber. Die fühlen sich wohl nicht so frisch, nach der Menge teuren Gins, den sie gestern beim Abendessen gebechert haben. Aber sie werden sicher bald aufstehen, um den guten Wellengang am Mittag zu erwischen. Sie beobachtet das Fenster und hält nach Bewegung Ausschau.
„Hey“, sagt jemand. „Willst du eins?“
Sie blickt herab. Im Pool ist ein gut aussehender, trainierter Surfertyp, der mit seinen gebräunten Händen zwei Flaschen Bier in die Höhe hält.
Sie deutet auf ihre Brust. „Wer, ich?“
Er grinst. „Ja, du.“ Er ist süß. Sein Blick ist direkt, sein Lächeln neugierig und für einen Augenblick ist sie versucht, beides zu erwidern. „Wie heißt du?“
„Wie ich heiße?“ Sie verzieht den Mund, um schüchtern zu spielen. Was ist ihr Name denn diese Woche? „Eliza.“
„Eliza.“ Der Typ nickt zufrieden. „Gefällt mir.“
Sie wiederholt den Namen ein paar Mal in ihrem Kopf, nur um sicher zu gehen. Eliza, Eliza. Ein Führerschein aus Westaustralien, eine Adresse in Adelaide, Kindergartenleiterin, sportbegeistert. Sie merkt, wie sich ihre Haltung verändert, eine subtile, aber notwenige Anpassung. Sie muss diese Person vollkommen verkörpern, sie ganz die Kontrolle übernehmen lassen. Nächste Woche wird es jemand anders sein, aber heute, hier, ist sie Eliza, Eliza, Eliza.
Der Typ im Pool flirtet noch eine Weile, aber als „Eliza“ darf Beth nicht darauf eingehen. Irgendwann kommt das Signal auch bei ihm an und er schwimmt davon, aber nicht, ohne ihr eins der Biere als „Geschenk“ dazulassen. Sie nimmt es erst an, als er ihr den Rücken zugekehrt hat, schnappt die Flasche schnell vom Boden und trinkt sie mit wenigen Zügen halb leer. Sie merkt den Alkohol schnell und für einen kurzen Moment geht es „Eliza“ fast gut. Aber dann erinnert sich die Person im Inneren an den Tag, der vor ihr liegt und all die Dinge, die sie tun muss und die Illusion löst sich in Luft auf.
Sie blättert in ihrem Notizbuch zurück, überfliegt die letzten Einträge und schreibt noch ein paar Zeilen zu dem Paar in dem Airstream. Dann lässt sie den Stift in ihren Schoß fallen und streckt die Beine aus. Sie trinkt ihr Bier aus, stellt es auf den Boden und blickt über den Zaun rund um den Pool, auf den Campingplatz dahinter. Eine Frau kommt gerade von den Duschen zurück, sie schreitet mit langen Beinen über das Gras, ihre Arme schwingen leicht nehmen ihr, ihr seidiges Haar fließt ihr über den Rücken. Sie ist braungebrannt und frisch und schlank. Sie trägt fast keine Kleidung und das scheint sie nicht zu stören.
„Eliza“ sieht zu, beobachtet die schwungvollen Schritte der Frau, ihren fröhlichen Rhythmus. „Eliza“ stellt sich vor, wie sie dieser Frau die Haut von ihrem fantastischen Körper zieht und hineinschlüpft, als wäre sie ein Kleid. „Eliza“ fragt sich, wie sie sich wohl über ihren eigenen Knochen anfühlen würde.
Und dann wird ihr Körper kalt, als ein Schatten über ihr Gesicht fällt.
„Hab dich“, sagt eine Stimme.
Beth dreht die Hitze so weit auf wie möglich und konzentriert sich auf das Prasseln des Wassers, das Zischen und Plätschern, als es auf die Fliesen trommelt. Aber so sehr sie es auch versucht, sie kann die Flut an Erinnerungen nicht aufhalten: das Stechen und Kratzen des Asphalts, das Schaukeln des Vans, die schrecklichen Schreie der Fahrerin … Was zur Hölle hat sie sich nur gedacht? Kein Wunder, dass die arme Frau völlig verängstigt gewesen war.
Ihr Magen zieht sich vor Schuldgefühlen zusammen und sie knetet sich Shampoo in die Haare, sodass der Schaum wie ein Wasserfall über ihren Nacken und Rücken fließt. Sie will nicht lügen, weder jetzt noch sonst irgendwann, aber was hat sie denn für eine Wahl? Sie hat kein Geld, kein Handy, keinen Ausweis, kein Transportmittel, keine Freunde und keine Familie. Irgendeine Erklärung wird sie zwangsläufig liefern müssen, aber ehrlich zu sein wird alles nur schlimmer machen.
Hab dich.
Nein, die Wahrheit ist keine Option. Und sie ist auch gar nicht nötig. Endlich laufen die Dinge rund. Oder wenigstens ist sie am Leben – und wenn sie will, dass das so bleibt, muss sie sich schnell eine ordentliche Deckgeschichte ausdenken.
Milchiges Wasser läuft über ihre Handflächen und tropft auf die Fliesen unter ihr. Sie wäscht sich den Kies aus den Schürfwunden und den Schlamm von der Haut, und als der Dreck weggeschwemmt wird, entsteht eine Idee. Sie überdenkt sie und wartet geduldig darauf, dass sie Gestalt annimmt. Eine Stimme erhebt sich in ihrem Kopf, hell und glockenklar. Sei selbstbewusst. Und schnell. Und ein Plan fügt sich zusammen.
Sie betrachtet ihn von allen Seiten, sucht nach Schwächen. Warum nicht? Sie hat es getan, sie kann es wieder tun. Sie muss auch gar nicht komplett überzeugend sein. Es reicht, wenn sie sich nur etwas Zeit erkauft.
Beth ignoriert die nagende Angst in ihrem Magen, dreht das Wasser ab, trocknet sich mit dem geliehenen Handtuch und zieht die sauberen Klamotten an, die ihre Retterin ihr so freundlich gegeben hat. Sie tritt aus der Dusche und ihr Spiegelbild blickt ihr aus der Reihe der Spiegel entgegen. Sie sieht immer noch schrecklich aus, die gestrigen Ereignisse haben tiefe Spuren auf ihr hinterlassen, aber die Dusche hat immerhin das Gröbste weggewaschen.
„Du bist eine ganz normale Frau, die eben alleine reist“, flüstert sie der Frau im Spiegel zu. „Und dein Name ist Lily.“
Lily, Lily, Lily.
Kapitel Sechs
Katy
„Mir gefällt dein Van“, sagt Lily und zuckt ein bisschen zusammen, als ich den Schnitt auf ihrer Stirn mit Desinfektionsmittel abtupfe. Es ist recht windig geworden, deshalb suchen wir drinnen mit geschlossenen Türen Schutz. „Hast du ihn selbst umgebaut?“
Ich werfe einen Blick auf die L-förmige Einbauküche. Meine Hand schwebt immer noch über ihrer Stirn, Wattebausch fest zwischen Daumen und Zeigefinger eingeklemmt. Jetzt, wo ich saubergemacht habe, ist die Schönheit des Umbaus klar zu erkennen. Hölzerne Arbeitsplatten, eine geflieste Küchenwand, Stahlarmaturen, ein Doppelbett. Der Van hat auch eine ordentliche Menge Stauraum (durch eine clevere Anordnung von Schubladen unter der Matratze, Schachteln zum Rausziehen, die sich auch als Sitzgelegenheiten eignen, Schränke und Schubladen in der Küche und einem extra Boden unter der Decke), sowie einen ausklappbaren Tisch und sogar einen Duschkopf, der über einen langen silbernen Schlauch mit dem Wassertank verbunden ist. Aber dafür kann ich leider nicht die Lorbeeren ernten.
„Ich habe ihn so gekauft“, sage ich. „Von einem Typen in Perth. Er hat das alles selbst gebaut. Hat mir eine super lange Tour davon über FaceTime gegeben, bevor ich ihn gekauft habe, und dann noch eine vor Ort, als ich ihn abgeholt habe.“
„Jedenfalls ist er sehr hübsch.“
„Danke.“ Hübsch fühlt sich nicht richtig an, aber ich denke ich weiß, was sie meint. Die wenigsten Umbauten gehen so weit, dass sie Wandpaneele, Leinenvorhänge und Dekokissen haben.
Ich tupfe weiter. „Stillhalten, ich bin fast fertig.“ Die Wunde sieht besser und weniger geschwollen aus, aber ich mache mir immer noch Sorgen, dass sie sich entzünden könnte.
Als ich so sicher bin, wie man es nur sein kann, dass sie sauber ist, klebe ich ein Pflaster darüber. Ich gebe Lily eine Tube Arnika Creme und ein paar Schmerztabletten, dann stelle ich meinen prall gefüllten Verbandskasten wieder in den Schrank unter der Spüle. Während sie sich um ihre Blutergüsse kümmert, gehe ich an den Herd und mache uns Tee.
„Danke“, sagt Lily, als ich ihr eine Tasse reiche. „Und noch einmal Entschuldigung, dass ich dir das alles hier aufhalse. Du bist unglaublich gutherzig. Ich weiß nicht, ob ich dasselbe getan hätte. Ein sonderbares Mädchen taucht einfach in deinem Van auf? Es überrascht mich, dass du nicht schon auf halbem Weg nach Darwin bist.“
Ich zucke mit den Schultern. „Du hast Hilfe gebraucht.“
Sie lächelt. Ohne das ganze Blut und den Dreck kann ich ihr Gesicht besser sehen: rund und unschuldig, mit zarten Gesichtszügen. Sie hat eine rundere Figur als ich – meine Klamotten sitzen bei ihr enger als bei mir – aber irgendwie schafft sie es, zierlich auszusehen. So wie sie dasitzt, im Schneidersitz, die Arme um ihre Mitte geschlungen, erinnert sie mich tatsächlich an ein vakuumverpacktes Päckchen, möglichst weit zusammengeschrumpft, um so wenig Platz wie möglich einzunehmen.
Wir verfallen wieder in Schweigen. Von außen klatscht der Wind gegen den Van. Ein Pferd wiehert und ein anderes schnaubt. Wenige Sekunden später antwortet ein Kookaburra, ein grauer Vogel, mit Gegacker.
Lily trinkt einen Schluck Tee und verzieht dabei kurz das Gesicht. „Du wartest sicher auf eine Erklärung.“ Ihre Stimme ist leise und heiser, und sie hat die Angewohnheit, ihre Kehle zu berühren, als würde sie so mehr Lautstärke heraufbeschwören wollen.
„Wann immer du bereit bist.“
„Also, ich war natürlich auch am Reisen. Hab dieses Loop Ding gemacht. Den Lap. Stand schon ewig auf meiner Bucket List. Ich hatte auch einen Van, einen viel kleineren als diesen. Aber ich hatte keinen wirklichen Zeitplan, an den ich mich gehalten habe. Habe einfach nur erkundet.“
„Alleine?“
Sie nickt.
„Ist das ein amerikanischer Akzent?“
„Illinois.“
„Wie lange bist du schon in Australien?“
Sie zuckt mit den Schultern: Wie tief ist das Meer? „Ich wollte mir diese natürlich entstandene Sonnenuhr anschauen, von der ich gehört hatte. Ich hab eine Abzweigung genommen, von der ich dachte, dass sie richtig ist, aber ich habe mich wohl verfahren. Und dann war ich plötzlich mitten im Nirgendwo, ohne GPS oder Orientierungssinn. Es war komisch. Normalerweise bin ich wie ein menschlicher Kompass.“ Sie hält inne und runzelt die Stirn. „Jedenfalls wurde es dann dunkel, also habe ich beschlossen, für die Nacht anzuhalten. Ich habe was gegessen, ein bisschen gelesen. Und dann habe ich draußen Geräusche gehört.“
Jetzt ist es an mir, die Stirn zu runzeln. „Geräusche?“
„Ja. So ein Klopfen. Wie Steine, die durch die Gegend getreten werden, weißt du?“
Ich kriege am ganzen Körper Gänsehaut. Lautes Atmen, Schritte, knirschender Stein.
„Ich wollte nachsehen, ob es andere Reisende waren, die auch die Sonnenuhr suchen. Aber …“ Lilys Hände zittern. Sie stellt ihre Tasse auf den Tisch. „Ich habe niemanden gesehen, also bin ich ein bisschen herumgelaufen. Es war leise, keine Geräusche mehr. Die Sonne war gerade am Untergehen, der Himmel war schön. Alles wirkte ok.“ Sie schließt die Augen. „Und dann war da ein anderes Geräusch: lauter, näher. Etwas hat mich gestreift. Und dann hat mich jemand gepackt. Genau hier.“ Sie berührt noch einmal ihren Hals.
„Und dann … Ich weiß es nicht mehr. Das Nächste, woran ich mich erinnern kann, ist, wie ich im Dreck liege, mitten in der Nacht, ich erkenne nichts wieder, mein Van ist weg und mit ihm all meine Sachen, mein Handy, Pass, meine verdammten Schuhe, einfach alles.“ Da verzieht sie das Gesicht und beginnt zu weinen. „Ich habe gesucht und gesucht, aber ich konnte den Van einfach nicht finden. Ich hatte keine Ahnung, was passiert war, wo ich war, was ich tun sollte. Also bin ich einfach aufgestanden und losgelaufen.“
Ich hole Küchenpapier und reiche ihr die ganze Rolle. Sie reißt sich ein Blatt ab und wischt sich damit über das Gesicht.
„Ich bin eine ganze Weile gelaufen, glaube ich. Und dann habe ich deinen Van gesehen, mitten in der Finsternis. Und die Lichter waren an, und er hat warm und sicher ausgesehen, und ich hatte solche Angst, mir ist nichts Besseres eingefallen, als reinzugehen und mich hinzulegen.“ Sie sieht zu mir hoch. „Es tut mir so leid. Ich habe einfach nicht nachgedacht, ich stand bestimmt unter Schock. Ich wusste einfach nicht, was ich sonst tun sollte.“ Sie reibt sich mit der Küchenrolle die Augen.
Ich denke einen Moment nach. Alleine, überfallen und ohne einen blassen Schimmer von was oder wem, alle Habseligkeiten weg … Mir ist schwindlig. „Bist du sicher, dass ich dich nicht ins Krankenhaus bringen soll?“
„Nein.“ Lily sagt das schnell und bestimmt und putzt sich die Nase. „Ich brauche nur eine Mitfahrgelegenheit nach Norden. Ich habe Freunde in Broome. Ich kann zu denen und dann weitersehen.“
„Willst du sie erst mal anrufen?“
„Was?“
„Deine Freunde. Du kannst mein Handy ausleihen. Damit sie Bescheid wissen.“
„Nein, ich … Also, ich könnte, aber …“ Lily sieht kurz weg und dann wieder zu mir. Sie seufzt. „Na gut, erwischt. Es gibt keine Freunde. Ich brauche nur einen Job und eine günstige Bleibe, bis ich einen Plan habe – aber ich muss auch unauffällig bleiben. Und Broome ist dafür ein guter Ort.“
„Warum musst du unauffällig bleiben?“
„Weil ich eigentlich gar nicht hier sein sollte. In Australien. Ich reise illegal. Ohne Visum.“ Sie lässt den Kopf hängen. „Darauf bin ich nicht stolz. Und ob du mir glaubst oder nicht, es war auch keine Absicht, es ist nur irgendwie so passiert. Aber das ist auch der Grund, aus dem ich nicht zur Polizei kann. Sie würden mich nur zurück in die USA schicken.“
„Und das wäre schlimm?“
„Ja“, sagt sie und blickt mir dabei direkt ins Gesicht. „Sehr schlimm.“
Wieder einmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Illegal. Mir springen Gedanken im Kopf herum – Antworten, Argumente, Lösungen – aber sie fühlen sich alle nicht richtig an. Stattdessen starre ich auf meine Knie, meine nackten Füße, den Boden des Vans. Neben meinem Bein sitzt ein Grashüpfer, grün wie ein Blatt und mit spitz zulaufenden Beinen und Fühlern. Ich richte meine Aufmerksamkeit auf ihn. Wie bist du denn hier hereingekommen? Irgendwie fühlt sich die Präsenz des Tiers wie ein gutes Omen an. Ich beschließe, dass es ein Mädchen ist.
„Weißt du, was komisch ist?“, fragt Lily. „Mir ist gerade klar geworden, dass ich dich gar nicht nach deinem Namen gefragt habe.“
Eine Welle der Beklemmung. Ich habe ihr nicht einmal meinen Namen gesagt. Wir sind wirklich zwei vollkommene Fremde, was tun wir nur hier? Plötzlich habe ich das so dringende Bedürfnis, allein zu sein, dass ich schreien könnte. Aber die Grashüpferin zu meinen Füßen legt ihren fremdartigen Kopf schief und blickt hoch. Sie winkt mit ihrem Fühler, als wollte sie sagen, keine Sorge, alles wird gut.
„Katy“, sage ich. „Katy Sweeney. Freut mich, dich kennenzulernen.“
Lily lächelt über die Formalität in meiner Stimme. „Ebenso.“
Eine weitere Pause. Ich sehe wieder zum Grashüpfer, in der Hoffnung auf weitere Bestätigung, aber sie ist weg. Meine kleine grüne Freundin ist verschwunden. Ich fühle mich seltsam verlassen.
Sobald Lily fertig verarztet ist, mache ich uns Müsli zum Frühstück. Wir essen am ausfaltbaren Tisch, als wären wir bei einem Vorstellungsgespräch – auch wenn ich nicht sicher bin, wer von uns die Arbeitgeberin ist und wer die Bewerberin.
Lily isst in kleinen, fast verstohlenen Bissen, als ob ihr jemand die Ohren langziehen und ihr verbieten könnte, weiter zu essen. „Woher kommst du?“, fragt sie.
„Sydney. Dulwich Hill. Vielleicht kennst du das?“
„Nein. Ich war nur einmal in Sydney, und das war nur, um die Oper zu besichtigen.“
„Ah.“
„Und du bist Lehrerin.“
„Wie bitte?“
Sie zeigt auf meine Brust. „Das ist doch ein Schulshirt, oder nicht? Was für Klassen unterrichtest du?“
Ich blicke auf mein zerknittertes Polohemd mit dem gestickten Logo der Marita Heights Primary School herab. Ich merke, wie ich rot anlaufe. Warum trage ich ein Shirt von der Arbeit? Ich sehe aus, als würde ich einen Ausflug leiten, oder als würde ich gerade Mittagspause machen. „Das kommt darauf an.“
„Aber gerade ist doch noch Schulzeit, oder? Ihr habt noch keine Ferien?“
Ich nicke und denke an mein Klassenzimmer, all die kleinen Tische, auf denen Eimer mit Stiften stehen, und frage mich, was meine Schüler wohl jetzt gerade machen. Ich bin noch gar nicht lange weg, aber sie fühlen sich schon Welten entfernt an. „Ich habe gerade Langzeiturlaub.“
„Wow. Lehrer haben es hier ziemlich gut, was?“
„Oh, klar. Fantastisch.“ Zeugnisse blitzen vor meinem inneren Auge auf. Elternabende, Stundenpläne, Kollegendrama, Busaufsicht, Benefizveranstaltungen, Verkleidungstage, standardisierte Tests, Schwimmunterricht, Entschuldigungen. Und dann die lange, heiße Sommerpause, diese wochenlangen gähnend leeren Tage und nichts, mit dem sie sich füllen lassen. So gut hatte man es hier.
„Und wie lange reist du jetzt schon?“
Ich zähle die Stunden. „Noch nicht lang.“
„Was hat dich dazu bewegt, damit anzufangen?“
„Eigentlich wollte ich das gar nicht. Nicht wirklich.“
Lily wartet darauf, dass ich weiterspreche und mein erster Instinkt ist es, aufzustehen, die Tür aufzuschieben und mich aus dem Van zu stürzen. Ich will ihr nichts erzählen. Aber bin ich nicht genau deshalb hier? Um mit Leuten zu reden? Fragen zu stellen? Ich atme tief durch und fische mein Handy aus der Hosentasche. Auf Phoebes Instagramseite suche ich eins der wenigen Fotos heraus, auf dem man ihr ganzes Gesicht sehen kann. Ich drehe den Bildschirm und Lily lehnt sich nach vorne.
„Wer ist das?“, fragt sie. „Deine Schwester?“
Ich merke, wie ein leichtes Lächeln meine Lippen umspielt. „Woran erkennt man das?“
„An den Augen. Und ein bisschen an der Mundpartie.“
Ich sehe nach, was sie meint. Mit den Augen hat sie recht, aber beim Mund bin ich nicht so sicher. Auf mich sind selten Kameras gerichtet, und wenn, dann lächele ich nur mit geschlossenem Mund. Aber wir haben so wenige Ähnlichkeiten, dass es ein schönes Gefühl ist, wenn jemand anders sie sieht, auch wenn ich nicht ganz zustimme. Ich fahre mir unbewusst durch die kurzen Haare und wünsche, es wäre so lang wie ihrs.
„Sie heißt Phoebe“, sage ich. „Letztes Jahr um diese Zeit hat sie dieselbe Route an der Coral Coast entlang gemacht. Auch allein. Sie wollte eigentlich den ganzen Big Lap machen, aber sie hat es nie aus dem Bundesstaat rausgeschafft. Nur drei Wochen nachdem sie in Perth losgefahren ist, ist sie spurlos verschwunden, und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Sogar ihr Van ist weg, all ihre Besitztümer, einfach alles. Als hätte sich der Boden aufgetan und sie verschluckt.“
Ich fühle Lilys Reaktion eher, als dass ich sie sehe. Ich kann sie nicht anschauen. Würde ich es tun, würde ich weinen.
„Niemand weiß, was passiert ist. Es wurde ermittelt, aber sie haben nichts herausgefunden. Es gab keine Hinweise, keine Spuren, keine Zeugen, keine Verdächtigen. Und vor kurzem haben sie die Ermittlungen eingestellt und einfach aufgegeben. So ganz ohne Anhaltspunkte fällt es manchen Leuten wohl schwer, die Hoffnung zu bewahren. Aber mir nicht. Ich weiß, dass sie noch irgendwo da draußen ist. Ich fühle es. Deshalb folge ich ihren Spuren, fahre ihre Reise vom Anfang bis zum Ende nach. Bis zu dem Ort, an dem sie verschwunden ist.“
„Mein Gott“, sagt Lily schließlich. „Das ist furchtbar. Es tut mir so leid.“
Furchtbar. Ja. Ich schiebe das Handy zurück in die Hosentasche und begegne ihrem mitleidigen Blick. Als Antwort strecke ich trotzig das Kinn in die Luft. „Entweder finde ich sie, oder ich finde heraus, was mit ihr passiert ist. Vorher gehe ich nicht nach Hause.“
Lily trinkt ihren Tee aus und wäscht ihre Tasse am Waschbecken aus. „Wo wurde sie zuletzt gesehen, wenn ich fragen darf?“
„Ningaloo. Eine Überwachungskamera an einer Tanke südlich von Exmouth hat sie gefilmt, wie sie am dritten Juni getankt hat. Noch am selben Tag hat sie auf Instagram gepostet, dass sie in den Schluchten in Karijini wandern gehen wollte. Und das ist das letzte, was sie geschrieben hat.“
„Also ist sie nie bei den Schluchten angekommen?“
„Soweit wir wissen nicht.“
„Scheiße.“ Lily dreht sich wieder zu mir und lehnt sich gegen die Küchenzeile. „Ningaloo bis Karijini? Das ist eine verdammt lange Fahrt, ungefähr 500 Kilometer. Und sie konnten es gar nicht eingrenzen?“
„Anscheinend nicht.“
„Und es gab überhaupt keine Verdächtigen? Niemand, der gesehen wurde, keine Anrufe von potenziellen Zeugen?“
„Niemand.“
Lily zupft an ihrem Ohrläppchen. „Ich verstehe das nicht. Sie muss doch auf dem Weg jemandem begegnet sein. Bist du sicher, dass sich wirklich niemand gemeldet hat?“
Ich unterdrücke meine wachsende Frustration, aber sie bemerkt sie trotzdem.
„Tut mir leid“, sagt sie schnell. „Natürlich bist du sicher. Ich will dich nicht dazu zwingen, das alles noch mal durchzumachen. Es ist nur … Wow, das ist ein ganz schönes Rätsel.“
Ich blicke aus dem Fenster. Ein paar Camper laufen mit einem Eimer voller Geschirr vorbei. Eine Frau mit Handtüchern und einem Kulturbeutel scheucht zwei kleine Kinder zum Duschblock. Hinter der sandigen Koppel verwandelt sich orangene Erde in Grasweiden und dann in eine Decke aus leuchtend grünen Hügeln.
Lily räuspert sich. „Hör mal“, sagt sie. „Das ist nur eine Idee und fühl dich bitte nicht unter Druck gesetzt, ja zu sagen, aber … kann ich vielleicht mit dir kommen?“
Ich blinzele. „Wohin?“
„Um nach Phoebe zu suchen.“ Ihre Augen sind groß und flehend. „Ningaloo oder Karijini, oder wo du auch landest. Ich weiß, dass das eine lange Strecke ist, aber ich kann ganz still sein und dir deinen Raum lassen, und es macht mir gar nichts aus, in der Fahrerkabine zu schlafen. Ich dachte nur, du weißt schon, ich will nach Norden, du fährst sowieso in die Richtung, und vielleicht könnte ich dir helfen, sie zu finden.“ Sie zuckt hilflos mit dem Schultern. „Vier Augen sehen mehr als zwei, oder?“
„Oh.“ Ich bin sprachlos. Den Van teilen? Mit einer verbrecherischen Fremden? Für achthundert Kilometer? „Also …“
„Ich bin ein guter Mensch“, unterbricht mich Lily ernst. „Und ich bin schlau, auch wenn alles für das Gegenteil spricht. Ich bin sauber und ordentlich, ich kann kochen, aber esse nicht viel und ich verspreche dir, dass ich dir jeden Cent zurückzahle, den ich dir schulde, sobald ich wieder auf den Beinen bin.“
Ich kaue auf meiner Unterlippe. Mein Verstand rast. Ich habe den Verdacht, dass Lily nicht ganz ehrlich zu mir ist, selbst nach ihrem Geständnis wegen des Visums. Irgendetwas stimmt nicht an der Erklärung, warum sie die Polizei meidet – und wenn sie in einer so dramatischen Situation ist, warum will sie dann nicht zurück in die USA? Aber, wie mir klar wird, ich kann sie nicht gehen lassen. Ich stecke schon zu tief drin. Ich will wissen, was mit ihr passiert ist. Ich will helfen. Und vor allem anderen fühlt sich mein Zusammentreffen mit ihr an wie ein Zeichen. Wie Schicksal. Es kann kein Zufall sein, dass ich auf der Suche nach dem Grund, aus dem Phoebe mit ihrem Van und allen Besitztümern verschwunden ist, auf eine andere allein reisende Frau treffe, die angegriffen und ihres Vans und ihrer Besitztümer beraubt wurde. Das muss das Universum sein, das mir einen Hinweis liefert.
„Bitte?“ Lilys Augen sind tränennass. „Ich kann nirgendwo anders hin.“
Ich öffne meinen Mund, um zu antworten, und …
Klopf, klopf, klopf.
Erschreckt wirbele ich herum.
Klopf, klopf, klopf.
„Hallo?“, fragt eine Männerstimme. „Jemand zu Hause?“
Mein Blick wandert zur Tür. Da draußen ist jemand.