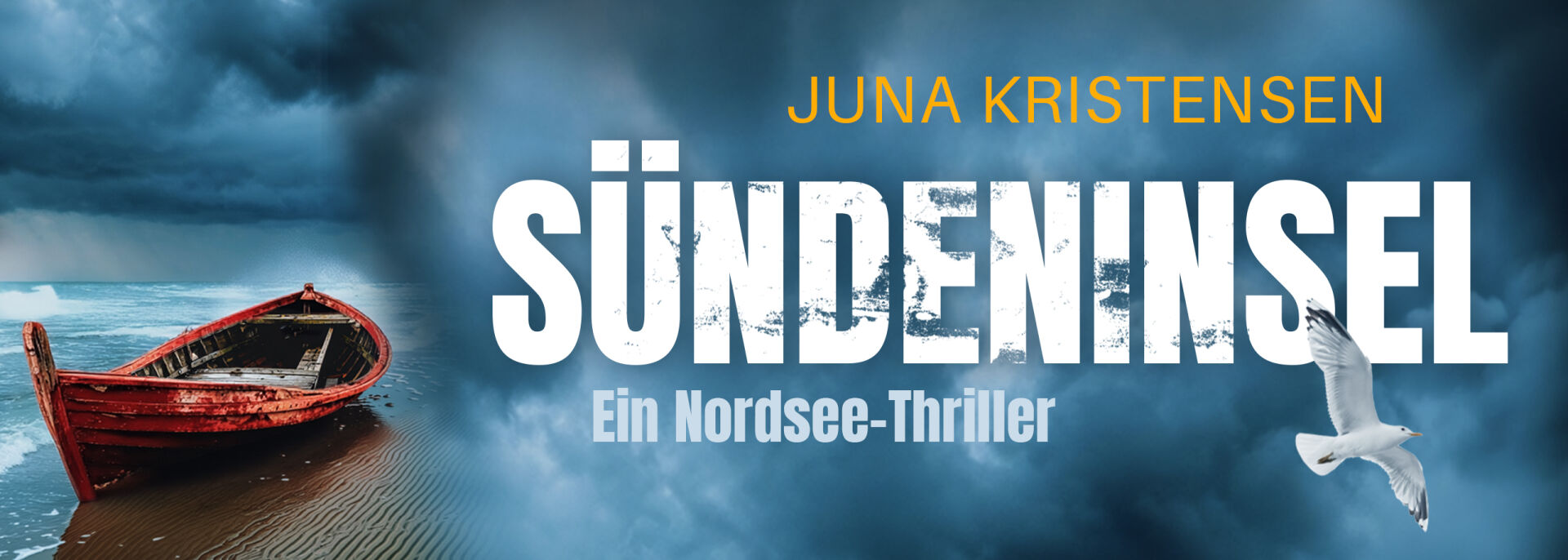Kapitel 1 – Elli
Sie erkannte sie sofort. Tia, echter Name unbekannt, wartete am Hauptbahnhof Bremerhaven auf sie. Elli wusste, dass sie es war, sah es an der Art, wie sie allein vor dem Café herumstand. Nicht freudig erregt, aber auch nicht gelangweilt, nicht ernst oder professionell, nichts von alldem und vielleicht alles zusammen. Sie wirkte, als wäre sie nicht wirklich hier, sah nicht auf ihr Smartphone, beobachtete nicht die Leute, sondern starrte einfach ins Leere. Elli erkannte sie an ihrem Verlorensein, das den Angehörigen oder Freunden verschwundener Personen irgendwie immer anhaftete.
Tias Blick fokussierte sich, als sie Elli bemerkte. Sie warf sich die blonden Dreadlocks über die Schulter und hob die Hand zum Gruß. „Du bist jünger, als ich dachte.“
„Das täuscht.“
Tias Blick war intensiv, sogar eine Spur misstrauisch. Fragte sie sich gerade, ob sie das Richtige tat? „Lass uns reingehen.“ Sie deutete auf das Bahnhofscafé hinter sich und ging dann vor, ohne eine Antwort abzuwarten.
Als sie sich mit ihren Getränken gesetzt hatten, legte das Mädchen ein kleines, grünes Kärtchen auf die Tischplatte. Die Hälfte der Vorderseite wurde von Tias Foto eingenommen, darunter der Schriftzug: Follow Me: @SustainableNorth. Auf der Rückseite befand sich sogar eine Telefonnummer.
Elli ließ die Visitenkarte in ihren Rucksack gleiten.
„Was jetzt? Wie läuft das hier ab?“, wollte Tia wissen.
Elli lächelte sie an. „Es geht um deine Freundin Yasmin, richtig?“ Die verzweifelte Nachricht, die sie gestern Abend auf Instagram erreicht hatte, war nicht allzu detailliert gewesen. „Kannst du mir erzählen, was genau passiert ist?“
„Sie ist verschwunden. Seit … oh Gott, ich weiß es nicht mal genau.“ Tia schniefte leise und die beiden silbernen Ringe in ihrer Nase wackelten.
Der Zusammenbruch. Elli wappnete sich innerlich. Manche erlebten ihn schon vor dem Treffen, jene wirkten ruhiger, hatten bereits alles rausgelassen, doch andere sparten ihn sich für diesen Moment auf, wenn sie ihr gegenübersaßen und sich endlich verstanden fühlten.
„Schon gut“, sagte Elli. „Nimm dir alle Zeit, die du brauchst.“
Tias Blick veränderte sich. Sie runzelte die Stirn und verschränkte die Arme über ihrem Patchworkkleid.
Elli erkannte den Fehler … zu spät. Sie hatte nicht auf ihren Tonfall geachtet. Hatte sie herablassend geklungen? Sie musste sich besser konzentrieren, sonst würde Tia einfach aufstehen und gehen. „Oder ich erzähle dir zuerst von mir“, bot Elli schnell an.
Tias Miene glättete sich. Sie nickte.
„Ich …“ Ellis Finger griffen automatisch nach dem Anhänger unter ihrem Mantelkragen. Ihre Kehle war plötzlich wie zugeschnürt, als sie über den glattgeschliffenen Bernstein strich. Sie wusste noch genau, wie Lou ihn getragen hatte: An einem Lederband, so eng am Hals, dass es einschnitt. Ihre Schwester, die nie die Aufmerksamkeit oder Blicke anderer gefürchtet hatte. Louise, die von allen nur Lou genannt worden war, und die es jetzt nicht mehr gab. Wie oft hatte Elli in den letzten Jahren ihre Geschichte erzählt, wieder und immer wieder dieselben Worte und ja, sie waren ihr von Mal zu Mal leichter von der Zunge gegangen. Warum also saß sie nun hier und brachte keinen Ton heraus?
Tias auffordernder Blick intensivierte sich und Elli spürte, wie ihre Wangen heiß wurden. War es so weit? Fühlte es sich so an, wenn man aufgab? Neunzehn Jahre, ein weggeworfenes Leben und sie suchte sich genau diesen Moment aus, um zuzugeben, dass alles umsonst gewesen war?
„Alles okay bei dir?“
Elli konnte nur den Kopf schütteln.
„Nimm dir ruhig alle Zeit, die du brauchst.“
Ihre Blicke trafen sich. Tias Mundwinkel zuckte. Ein Lachen brach aus Elli hervor, das sich eher wie ein Husten anhörte, doch es war befreiend, ebenso wie die Tränen, die ihr über die Wangen liefen. Als sie die Nässe wegwischte und Tia endlich wieder ins Gesicht sehen konnte, bemerkte sie, dass das Mädchen ebenfalls weinte.
„Es tut mir leid“, brachte Elli hervor. „Das ist mir noch nie passiert. Aber ich glaube …“ Sie schluckte hart. Sollte sie es wirklich sagen? „Ich glaube, dass ich das nicht mehr kann.“
„Elli … du heißt doch Elli, oder? Wie lange suchst du schon nach …“
„Meiner Schwester“, krächzte sie. „Seit neunzehn Jahren.“
Tia stieß den Atem aus. „Mein Gott, Elli.“ Mehr sagte sie nicht. Drückte kein Bedauern aus, kein Mitleid, belehrte sie nicht, dass sie irgendwann die Realität akzeptieren und ihr Leben leben müsse. Sie saß nur da, abwartend, doch es war ein freundliches Schweigen.
Elli rang sich ein Lächeln ab. „Du machst das gut.“
„Das sagt Yasmin auch immer. Du solltest Lebensberaterin werden oder ein E-Book schreiben, statt Insta und TikTok mit Bio-Quatsch vollzuspammen. Aber Nachhaltigkeit liegt mir nun mal am Herzen und als Content Creator braucht man genauso viel Feingefühl wie als Psychologin, sage ich immer, wenn nicht mehr. Hast du Lust, einen Spaziergang zu machen?“
***
„Hundertvierzig Fälle.“ Tia pfiff durch die Zähne.
Die dunklen Wolken hingen tief über dem Weserdeich, auf dem sie entlanggingen. Links von ihnen erstreckte sich Wasser, vor ihnen erhob sich der felsige Bau des Zoos am Meer.
„Mehr oder weniger.“ Elli zog den Reißverschluss ihres abgetragenen Steppmantels bis unters Kinn. Der November war kalt dieses Jahr, die Temperaturen näherten sich bereits dem Nullpunkt.
„Wie hast du das …?“ Tia räusperte sich, suchte nach den richtigen Worten. „Ich meine, das muss doch ziemlich viel Zeit gekostet haben.“
Elli wusste genau, was sie eigentlich fragen wollte: Arbeitest du nicht? Was ist mit einem Studium, einer Ausbildung? Wie alt bist du eigentlich?
„Ganz am Anfang war es nur eine winzige Website, auf der ich nach Mithilfe bei der Suche nach meiner Schwester gebeten habe. Aber als das mit den Social-Media-Kanälen anfing – ich weiß auch nicht, ich wurde auf Facebook und Instagram verlinkt und plötzlich bekam ich eine Nachricht nach der anderen von Menschen, die eine Freundin, eine Schwester oder Tochter suchten. Da hab ich mein Studium abgebrochen. Das ist schon über zehn Jahre her. Seitdem jobbe ich, aber vermeide alles, was zu viel Zeit kostet.“
„Und in all den Jahren, bei all den Vermisstenfällen, gab es keinen Hinweis auf deine Schwester? Keinen verdammten einzigen?“
Elli schüttelte den Kopf. Anfangs hatte sie das Auf und Ab der Emotionen jedes Mal mit durchlebt, mit jedem vermissten Mädchen. Die Trauer, die Verzweiflung und für eine Weile sogar die Euphorie, wenn die Gesuchte wieder auftauchte. Elli hatte sich gefühlt, als hätte sie selbst einen Beitrag zu dem guten Ausgang geleistet, als hätte sie irgendetwas getan und nicht nur dagesessen und zugehört. Dann war der Tag gekommen, an dem sie zum ersten Mal in die besorgten Augen einer Mutter geblickt hatte, wissend, dass ihre Tochter bald von allein heimkehren würde, weil es bei jedem anderen Fall ganz genauso gewesen war. Und Elli hatte sich gefragt, wie diese Frau ihr das antun konnte.
Du tust es dir doch selbst an, hatte Lous Stimme in ihrem Kopf gesagt.
Sie war das Einzige, das Elli wieder klar denken ließ, wenn die Hätte dochs und Wäre dochs über sie hereinbrachen.
Hätte Lou Damian doch gar nicht erst kennengelernt.
Oder, ganz von Anfang: Hätte Lou nie mit dem Modeln begonnen, nicht zu essen aufgehört und niemals die Bibel mit nach Hause gebracht. Ihre Schwester musste etwa vierzehn gewesen sein, als die Annonce in der Tageszeitung gestanden hatte.
Kindermodelle gesucht. Niemand war auf die Idee gekommen, Elli zur Bewerbungsveranstaltung mitzunehmen. Sie, die zwar die Sommersprossen und die braune Haarfarbe mit ihrer Schwester gemein hatte, aber weder deren ebenmäßige Gesichtszüge noch himmelblauen Augen besaß. Die hübsche Große und die süße Kleine, hieß es immer. Wobei süß in diesem Fall nur ein Synonym für klein war.
Dreizehn Jahre, seit Elli beschlossen hatte, ihr komplettes Leben auf Eis zu legen, bis sie Lou wiedergefunden hatte. Nur übergangsweise, hatte sie sich gesagt. Bis sie eine Spur fand … bis sie endlich damit abschließen konnte. Bereute sie es?
Gib es ruhig zu.
Ellis Blickfeld verschwamm.
Du Schaf. Heulst du schon wieder?
„Ehrlich“, drang Tias Stimme zu ihr durch, „jede andere hätte längst aufgegeben, sich mit Antidepressiva vollgepumpt oder mit Schlaftabletten überdosiert. Ich meine, hey, neunzehn Jahre, Elli! Vierzehn, seit du deinen Blog begonnen hast. Das ist fast dein halbes Leben. Bist du sicher, dass du jetzt aufhören willst?“
Elli nickte. Was hatte Tia an sich, dass sie diese Dinge plötzlich nicht nur vor einer Fremden, sondern insbesondere vor sich selbst zugeben konnte? Als hätte sie nur darauf gewartet. Auf jemanden, der sie verstand. „Es ist Zeit“, sagte sie. Ihre Stimme war fest und die Tränen versiegt. „Ich glaube, tief in mir drin wusste ich es schon lange. Und irgendwas an dir … Es ist unheimlich leicht, mit dir zu reden. Deine Freundin Yasmin hat recht: Du wärst eine tolle Lebensberaterin.“
Tia wandte ihr Gesicht ab.
„Erzähl mir von ihr“, bat Elli. „Bitte.“
„Ich glaube, es ist meine Schuld.“ Tia starrte aufs Wasser. „Ich bin immer der schlechte Einfluss gewesen. Ihre Eltern sind schon lange gegen die Freundschaft, aber Yasmin lässt sich ja nichts sagen. Es muss was mit dieser dämlichen Brotherhood zu tun haben.“ Abrupt blieb Tia stehen und fasste Elli bei den Unterarmen. „Mit denen stimmt was nicht. The Brotherhood of Samael, so ein Satanisten-Club. Wir waren neugierig, wollten was Verrücktes ausprobieren. Man kann bei denen einfach auf die Website gehen, schreibt eine E-Mail, füllt einen Fragebogen aus und schon wird man zu einem Treffen eingeladen. Ich war nur einmal da, das war mir viel zu weird. Die Leute da … Yasmin und ich waren uns einig, dass wir da nicht mehr hingehen, aber dann war ich so abgelenkt wegen Oaty, meiner Ratte – er musste eingeschläfert werden, weißt du, wegen eines Tumors – und ich konnte echt mit niemandem reden, ich musste das mit mir selbst ausmachen. Als es mir besser ging, war Yasmin nicht mehr zu erreichen. Ich bin dann zur Brotherhood und hab mich umgehört und anscheinend war Yasmin ohne mich da und wurde von irgend so einer komischen Tante angequatscht, mit der sie mitgegangen ist. Ich habe wieder und wieder bei ihr zu Hause angerufen – nichts. Ich weiß schon, wonach das aussieht, aber Yasmin ist nicht so eine, die sich von ihrer Familie wegschiffen und mit irgendeinem Cousin verheiraten lässt. Dann würde ihre Mutter mir es doch auch klipp und klar sagen, oder? Ich glaube …“ Sie schniefte laut und zog die Nase hoch, doch die Tränen kullerten weiter. „Ich glaube, dass sie tot ist.“
Der Wind heulte leise an ihnen vorbei, vorsichtig, wie, um den Moment nicht zu zerstören.
Elli war wieder vierzehn.
Sie erinnerte sich genau an den Augenblick, kurz, nachdem Lou aufgelegt hatte, als ihr klarwurde, was ihre Schwester da gesagt hatte. Während des Anrufs war sie so mit sich selbst beschäftigt gewesen, mit der Wut auf Lou, die sich wie immer auf ihre verletzende Art in Dinge einmischte, die sie nichts angingen. Erst eine gute halbe Stunde später, als sie wieder im Bett lag und einzuschlafen versuchte, war der Unmut verflogen gewesen und ihr war aufgefallen, dass Lous Stimme seltsam geklungen hatte. Gepresst irgendwie, und ein bisschen abgehackt, fast so … fast so, als hätte sie während des Telefonats geweint. Sicher konnte Elli sich nicht sein, denn sie hatte ihre Schwester nicht weinen gesehen, seit diese elf oder zwölf gewesen war, aber dieser Tonfall zusammen mit dem Inhalt ihrer Worte ließ Elli schnellstens wieder nach dem Telefon greifen und Damians Festnetznummer wählen. Es tutete zehn, fünfzehn Mal. Sie versuchte es noch mehrmals am nächsten Morgen, ohne Erfolg. Nach der Schule fand sie den Bernstein im Briefkasten. Sie schrieb Lous Worte auf, weil sie dachte, sie so objektiver beurteilen zu können. Doch sie zu sehen, in blauer Kulischrift auf einem weißkarierten Blockblatt, war viel schlimmer, als sie nur in ihrem Kopf zu haben. So schlimm, dass sie nicht atmen konnte und ihre Mutter angestürmt kam, erst das Geschriebene, dann die Kette und schließlich Elli selbst mit tränengefüllten Augen anstarrte. Da wusste Elli, dass sie recht gehabt hatte. Es waren Abschiedsworte gewesen.
Sie schlang die Arme um Tia. Unbeholfen strich sie der anderen über den Rücken, fuhr Kreise über die dicke Schafswolle, während sie spürte, wie Tias Oberkörper vor Schluchzern zuckte. Doch erst, als das Mädchen die Umarmung erwiderte, als Elli spürte, wie sie gehalten wurde, brach ihr eigener Damm. Sie wusste nicht, wie lange sie dort standen und weinten, um die Menschen trauerten, die sie verloren hatten.
Lou hatte ihr ganzes Leben lang gegen sich selbst gekämpft und im Alter von zwanzig Jahren aufgegeben. Es war niemandes Schuld. Sie hatte sich umgebracht und ja, es war seltsam, dass die Leiche niemals gefunden worden war. Manchmal gab es eben keine Erklärung. Zumindest keine, die Elli jetzt, neunzehn Jahre später, noch zu finden imstande war.
„Ich denke die ganze Zeit an Yasmins letzte Message.“ Tia löste sich vorsichtig aus der Umarmung. Sie zog Taschentücher aus ihrer Jackentasche, hielt Elli eins hin und schnäuzte sich die Nase. „Warum über WhatsApp? Wieso hat sie mich nicht angerufen? Und dann die Wortwahl, es klingt so gar nicht nach Yasmin. Ich will sie so in Erinnerung behalten, so stark, wie sie sich selbst gesehen hat. Auch, wenn sie mich anscheinend für schwach hielt. Das stört mich irgendwie schon. Verrückt, oder?“ Tia lachte auf, freudlos, bitter. „Ich meine, als wäre es meine Schuld. Wenn ich nur stärker gewesen wäre, so wie sie, hätte sie sich mir anvertrauen können.“
Du warst einfach zu schwach. Ich hätte dir ja gern erzählt, was ich vorhatte, wenn du nur stärker gewesen wärst. Derselbe Vorwurf, der in Lous Stimme seit neunzehn Jahren in Ellis Kopf widerhallte, doch ihrem eigenen schlechten Gewissen entsprang. „Was?“ Ihr Mund war staubtrocken. Elli schluckte einmal, zwei Mal, bevor sie die Fragen herausbrachte. „Was stand in dieser letzten Nachricht? Erinnerst du dich an die genauen Worte?“
„Na klar, das war ja erst gestern und deshalb hab ich dir ja überhaupt erst über Instagram geschrieben. Hier, ich zeig sie dir.“
Die Zeit schien zu stoppen, während Elli las, ebenso die Geräusche, sogar ihr Blickfeld verkleinerte sich. Für den Moment bestand die Welt nur noch aus Tias Handy. Die schwarzen Buchstaben sahen ganz anders aus als Ellis eigene kuliblaue Schreibschrift auf dem karierten Zettel, damals vor neunzehn Jahren. Doch es waren die gleichen Wörter, bis auf den letzten Buchstaben.
Spätabends an einem Donnerstag hatte Lou Elli aus dem Bett geklingelt. Es war das erste Mal, dass ihre Schwester abends anrief. Sie hatte diese seltsame Botschaft aufgesagt, mit einer Stimme, die Elli fast nicht wiedererkannt hatte. Ratlos, was sie darauf antworten sollte, hatte sie die unangenehme Stille mit der Geschichte von ihrem ersten Freund ausgefüllt.
„Du Schaf“, hatte Lou gesagt. „Nur weil alle erwarten, dass du mit dem Langweiler gehst, musst du es noch lange nicht tun.“
Da hatte Elli aufgelegt. Und eine gute halbe Stunde gebraucht, um zu merken, dass an diesen ersten drei Sätzen des Telefonats etwas ganz und gar nicht gestimmt hatte:
Wenn es etwas Gutes in diesem Leben gab, dann warst du es. Und obwohl du nicht stark genug bist, mir auf meinem Weg zu folgen, so werde ich mich doch immer an dich erinnern. Und wer weiß, vielleicht sehen wir uns in einem anderen Leben wieder.
Elli starrte Tia an.
Das war er.
Nach neunzehn Jahren und hundertvierzig Vermisstenfällen.
Der Zusammenhang.
Kapitel 2 – Elli
„Ich muss die Person finden, die zuletzt Kontakt zu Yasmin hatte! Du meintest doch, da gibt es jemanden bei der Brotherhood. Eine Frau?“ Ellis Herz wummerte gegen ihre Rippen. Sie war so kurz davor gewesen, aufzugeben.
Tia nickte. „Ja, genau. Warte kurz …“ Tia zückte ihr Handy. „Hey! In der WhatsApp-Gruppe schreiben sie, dass sie sich heute Abend wieder treffen. Anscheinend kommen aber nur wenige, ist ja ein Wochentag.“
„Das ist mir egal. Ich muss da hin!“
„Klar doch. Wir gehen zusammen.“ Tia lächelte Elli immer wieder von der Seite zu, während sie sich der Bushaltestelle näherten. Es war unübersehbar. Die geduldige, freundliche Miene und der vorsichtige Tonfall: Mitleid. Elli konnte es ihr nicht verdenken. Ein Zusammenhang zweier Vermisstenfälle, die neunzehn Jahre auseinanderlagen?
Der Nieselregen benetzte Tias Smartphone-Bildschirm. Sie schaute sich irgendetwas auf Instagram an.
Das ist okay, sagte sich Elli. Tia verstand nicht, wie besonders dieser Zusammenhang war, konnte es nicht.
„Oh“, machte Tia. „Oh, Mann.“ Etwas zwischen einem Räuspern und einem Seufzen kam aus ihrem Mund, als hätte Tia sich an ihrem eigenen Atem verschluckt. „Elli!“, schrie sie plötzlich so laut, dass die anderen Wartenden die Köpfe nach ihnen umwandten. Sie hielt ihr das Smartphone vors Gesicht. Elli versuchte, zu begreifen, was sie da sah. Der Kommentarabschnitt unter einem Post. Tia ging es anscheinend zu langsam. „Jemand hat Yasmin gesehen! Komm!“ Sie packte Elli am Arm, zerrte sie mit zu dem Bus, der gerade an der Haltestelle zum Stehen gekommen war. Es war nicht der, den sie eigentlich hatten nehmen wollen. Tia klemmte ihren Fuß in die Tür. Die Stimme des Fahrers schallte ungehalten durch den Lautsprecher, doch der Wortlaut drang nicht zu Elli durch. Im nächsten Moment hatte sie wieder den Handybildschirm vor sich. „Gestern, nachdem ich die seltsame Nachricht von Yasmin gelesen habe, war mir klar, dass etwas nicht stimmt, und ich habe ihr Foto auf allen meinen Kanälen gepostet. Ich dachte, es schadet ja nichts, es zu versuchen. Und jetzt das! Jemand hat einem Mädchen letzte Woche mit ihrem Gepäck am Hauptbahnhof geholfen. Und es sah genauso aus wie Yasmin!“
Ellis Blick fokussierte sich auf den mit den Busbewegungen mitschwingenden Bildschirm, der nun ein Mädchen mit Kopftuch und gelbem Anorak zeigte. Die großen, dunklen Augen blickten direkt in die Kamera.
„Er sagt … warte, hier … sie trug kein Kopftuch, deshalb ist er sich nicht sicher, aber sie hatte dieselbe Jacke an. Sie trug eine riesige Tasche und fiel beinahe rücklings um, als sie einsteigen wollte.“ Tia keuchte, sie redete so schnell, dass sie anscheinend nicht genug Luft bekam. „Dann, als er ihr das Gepäck abnahm und rein trug, hat sie sich nicht mal bedankt. Das ist Yasmin! Sie hat genau so ein Ungetüm von Tasche und sie hasst es, wenn man ihr Hilfe anbietet. Alles will sie selbst machen.“ Tränen glitzerten in Tias Augenwinkeln.
Ellis Gehirn kam einfach nicht hinterher. Yasmin war gesehen worden. Wenn Yasmin einfach in irgendeinen Zug gestiegen war, um ihrem alten Leben zu entfliehen, was bedeutete das dann für den Zusammenhang zwischen ihr und Lou? Dass er nicht existierte? Dass Elli sich in etwas verrannt hatte? Sie wischte verstohlen über ihre Augen und zog die Nase hoch. „Wohin ist Yasmin denn gefahren?“
„Es war die Regionalbahn nach Cuxhaven. Ich meine, die fährt doch mitten durchs Nirgendwo, da gibt es nicht viele Möglichkeiten, wo sie ausgestiegen sein könnte. In Cuxhaven selbst … puh, ich weiß nicht, ich war da nur einmal mit der Schule, um was übers Wattenmeer zu lernen. Ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, was Yasmin da will. Sie ist mehr der fünfunddreißig Grad im Schatten-Typ, keine windbegeisterte Wattwanderin. Aber … warte mal, ich glaub, sie hat Verwandte da! Ja, ja, ich bin mir sicher, sie war da mal auf einer Hochzeit und hat mir danach Fotos gezeigt. Der Bruder ihrer Schwägerin oder so ähnlich. Elli? Gehts dir gut?“
Das Wattenmeer.
Was für ein Glück wir doch haben, hatte ihre Mutter oft gesagt. Ein Urlaubsort direkt vor der Haustür.
Eine Stunde Autofahrt nur, da würde es sich sogar lohnen, einfach mal ein verlängertes Wochenende hinzufahren.
Irgendwann einmal, wenn die Kinder etwas älter sind und ihnen im Auto nicht mehr schlecht wird. Nächstes Jahr, wenn Papa mehr Urlaub hat.
Sie flogen nach Mallorca, nach Italien, nach Griechenland. Ihre Mutter hörte nie auf, von der deutschen Nordsee zu sprechen. Es könnte doch nicht angehen, dass sie bald zehn Jahre in Bremen wohnten und noch nie das Wattenmeer gesehen hatten. Dann kam jener Sommer, ausnahmsweise stand kein Ferienflug an. Der Vater war dagegen. Die Kinder sind doch längst zu alt, um im Sand zu spielen. Lass uns lieber zu meiner Schwester in den Harz fahren.
Doch ihre Mutter war standhaft geblieben. Elli musste acht oder neun gewesen sein. Es war ganz anders als auf Mallorca, in Italien oder Griechenland. Kein All Inclusive, keine windstille Hitze, kein Pool, ja, meistens nicht mal ein Meer. Es waren zwei Wochen voller Wattwanderungen und hüfttief gebuddelter Löcher im Sand gewesen. Elli erinnerte sich an von Wind und Salz verklebte Haare, den Sonnenbrand auf ihren Wangen und feine Schnitte in den Fußsohlen, wo sie in Muscheln getreten war. Sie und Lou aßen Eis im Strandkorb, dessen Sitze immer voller Sand waren, fingen Krebse in bunten Plastikeimern und aßen am Nachmittag Kuchen auf der Terrasse ihres Ferienhauses. Es war einer ihrer letzten Familienurlaube gewesen. Kurz nachdem Lou mit dem Modeln angefangen hatte, doch bevor sie so viele Termine hatte, dass an Verreisen nicht mehr zu denken war. Und später, als alle sich Sorgen um Lous Gesundheit machten, als Streits mit Tränen und Türenknallen an der Tagesordnung waren, hatte niemand mehr Lust und Energie aufgebracht, Urlaube zu planen.
Nicht nur für Elli war jener Urlaub etwas ganz Besonderes gewesen. Die Erinnerung war so klar, als sei es nicht fünfundzwanzig Jahre, sondern wenige Tage her. Die Erinnerung an den Fleck im Watt. Bei klarem Wetter wirkte er wie ein Felsen, mit unregelmäßigen Zacken und Spitzen.
Eine Insel, der Name war Elli entfallen. Lou und ihre Mutter hatten an einem Ausritt dorthin teilgenommen, waren auf hellbraunen Fjordpferden in einer großen Gruppe aufgebrochen. Mit Matschspritzern im Gesicht, roten Wangen und von einem Ohr bis zum anderen strahlend, war Lou fünf Stunden später wieder vom Pferd gestiegen, als Elli und ihr Vater die beiden mit dem Auto vom Reiterhof abgeholt hatten. Ein Ort, an dem die Zeit still zu stehen scheint, hatte Lou erzählt. Ein hässlicher Leuchtturm, der gar nicht wie einer aussah, ein Platz, wo die Pferde rasteten und die Reiter beim Inselkaufmann Tee und Brote erwerben konnten. Ein paar Herbergen und Ferienhäuser. Ein hölzerner Schiffsanleger. Einige Pferde und etwas über dreißig Insulaner. Natur. Umgeben von der rauen Nordsee. Man konnte zum Festland reiten oder sogar laufen, aber die breiten, tiefen Priele machten dieses Unterfangen insbesondere bei Wind und Regen zum Glücksspiel. Kam man heute durch und morgen nicht wieder zurück? Einige Insulaner besaßen Wattwagen oder Trecker, mit denen sie hin und wieder zum Festland fuhren und einkauften, doch auch diese mussten im Winter oft genug umkehren, weil das Watt sogar bei Niedrigwasser unpassierbar blieb.
Selbst, nachdem sie längst wieder zu Hause gewesen waren, hatte Lou weiter von der Insel geredet. Hatte Bilder gemalt, von Pferden bei Sturm im Watt, von einem schmucklosen, eckigen Gebäude, das der Leuchtturm sein musste.
Wenn ich erwachsen bin, werde ich dort leben. So einsam und doch Teil einer Gemeinschaft. Gibt es etwas Romantischeres? Das war vor der Bibel gewesen. Danach hatte Lou die Insel nicht wieder erwähnt. Den Bernstein jedoch hatte sie weiterhin getragen. Den Bernstein, den sie in jenem Urlaub im Watt gefunden und zu einem Anhänger hatte schleifen lassen. Den Elli selbst seit neunzehn Jahren um den Hals trug. Wieso hatte sie niemals den Zusammenhang gesehen?
„Ich glaube, ich weiß, wo meine Schwester sich das Leben genommen hat.“
„Bist du dir sicher?“, fragte Tia zum bestimmt zehnten Mal.
Elli nickte.
„Ich kann auch mit nach Cuxhaven kommen und …“
„Du musst zur Brotherhood, Tia. Wenn Yasmin jemandem gesagt hat, warum und wohin sie geht, dann vermutlich ihrer neuen Freundin, die sie dort kennengelernt hat. Wenn ich mit der Insel falsch liege …“
„Was, wenn du recht hast? Wenn Yasmin wirklich dort ist …“
„Heute können wir sowieso nichts mehr tun. Morgen früh kommst du nach und wir suchen gemeinsam einen Weg hinüber. Ich warte auf dich, versprochen.“
Tia schwieg, doch ihr Blick verriet deutlich, was sie dachte: Warum bleibst du dann nicht hier und wir fahren morgen zusammen nach Cuxhaven?
Elli konnte es selbst nicht erklären, aber sie musste die Insel sehen. Allein. Diesen Fleck im Meer, an den sie seit fünfundzwanzig Jahren nicht mehr gedacht hatte und der ihr die Schwester genommen hatte. Egal, wie rational sie sich Tia gegenüber gab, Elli war sich sicher.
Der Zug fuhr ratternd in den Bahnhof ein. Die Türen öffneten sich und eine Welle an Pendlern quoll heraus. Elli lächelte Tia zu. Sie wollte gerade einsteigen, da griff das Mädchen nach ihrer Hand.
„Wir sehen uns morgen“, sagte Elli, konnte die Ungeduld in ihrer Stimme aber nicht ganz kaschieren.
Doch Tia ließ nicht los. Andere Reisende schoben sich an ihnen vorbei, stiegen in die Regionalbahn, die jeden Moment ihren Rückweg nach Cuxhaven beginnen würde. Schon schlossen sich die Türen.
„Pass auf dich auf“, sagte Tia und gab Ellis Hand frei. „Ich schreibe dir später, was bei der Brotherhood herausgekommen ist.“
Elli drückte hektisch auf den Türknopf und zu ihrer Erleichterung blinkte er grün. Die Bahn öffnete sich. Kaum war Elli eingestiegen, glitten die Türen schon zwischen sie und das Mädchen, das sie erst seit heute kannte, doch in dem sie etwas gefunden hatte, von dem sie nicht geglaubt hatte, dass es existierte: Eine Freundin, die sich nicht nur um sie sorgte, sondern die sie verstand. Elli wollte noch etwas sagen, durch die Scheibe hindurch rufen, doch da fuhr die Bahn an. Mit einer ans Glas gepressten Wange behielt sie Tia im Blick, die einsam auf dem Bahnsteig stand und immer kleiner wurde.
***
Sie hielten an Bahnhöfen, die den Namen nicht verdienten, die kleiner waren als S-Bahn-Haltestellen in der Stadt. Dahinter, soweit Elli es unter der spärlichen Straßenbeleuchtung erkennen konnte, Einfamilienhäuser, einspurige Straßen, kahle Bäume, Felder. Mit jedem Stopp leerte sich die Bahn zusehends, berufstätige Eltern und Jugendliche gingen nach Hause, es war mittlerweile halb sechs. Der frühe Sonnenuntergang war nicht allein für die Dunkelheit verantwortlich, sondern auch schwere Gewitterwolken, die Mond und Sterne verdeckten.
Elli holte ihr Handy heraus und buchte im Stadtteil Duhnen ein billiges Zimmer für die Nacht. Außerdem hinterließ sie eine Nachricht auf der Arbeit, meldete sich gleich für den Rest der Woche krank. Selbst wenn ihre Chefin das zum Anlass nahm, ihren Vertrag nicht zu verlängern – den Drogeriejob, bei dem sie täglich um sechs Uhr antrat um die Regale aufzufüllen, würde sie nicht vermissen.
Sonst gab es niemanden, den Elli benachrichtigen müsste, dass sie kurzfristig wegfuhr. Keine enge Kollegin, keine Freunde, nicht mal ein Haustier, das sie vermissen würde. Aus ihrer Familie waren nur noch Elli und ihr Vater übrig. Oder eher: Elli. Und ihr Vater. Sie beide in einem Satz zu nennen war, wie einen Badeanzug unter einem Wintermantel zu tragen. Es machte keinen Sinn, weil es nicht zusammengehörte. Schon vor Lous Verschwinden und dem Tod der Mutter hatten sie nicht viel miteinander zu tun gehabt, doch während der letzten drei Jahre war der Kontakt auf WhatsApp-Glückwünsche zum Geburtstag geschrumpft.
Die Ereignisse des Tages waren so plötzlich über Elli hereingebrochen, dass sie nicht einmal Zeit gehabt hatte, nach Hause zu fahren und ein paar Sachen zu packen. Nach all den Jahren folgte Elli endlich einer Spur. Wie seltsam, dass sich gerade jetzt ein kleiner Teil von ihr wünschte, einfach in ihre kalte, ungemütliche Wohnung heimkehren zu können. Die knarzenden Stufen nach oben steigen, durch das Treppenhaus, in dem stets der Geruch nach Suppe hing. In ihrer Wohnung dem Geschrei der Nachbarskinder lauschen, der Schelte der Mutter. Auch hier roch es, doch anders als im Treppenhaus, feucht-muffig, nach den dunklen Tupfern, die sich halb hinter der ergrauten Gardine verborgen bis zur Decke zogen: Schimmel, weil sie zu wenig heizte und noch seltener lüftete. Einfach wieder zitternd vor Kälte mit ihrem Laptop am Klapptisch sitzen, in dem einen Zimmer, aus dem ihre ganze Wohnung bestand. So, wie sie es jahrelang getan hatte. Zwischen Küchenzeile und Kleiderschrank stand der Karton mit Lous Sachen. Unwichtiger Krimskrams, den ihre Schwester zurückgelassen hatte, als sie zu Damian gezogen war, doch den Elli nicht übers Herz brachte wegzuwerfen.
Was würde sie auf der Insel finden?
Ein Teil von ihr fürchtete sich vor der Wahrheit, hatte sich zu sehr an den Gedanken gewöhnt, niemals Gewissheit zu erhalten.
Wie konnte es sein, dass zwei Mädchen, die sich nicht gekannt hatten, die absolut nichts miteinander gemein hatten, zwischen deren Verschwinden neunzehn Jahre lagen, die genau gleichen Abschiedsworte gebrauchten? Und dass das eine Mädchen beim Einsteigen in eine Bahn gesehen wurde, die zu einem Ort fuhr, von dem das andere Mädchen als Teenager besessen gewesen war?
Elli war erleichtert, dass Tia nicht vorgeschlagen hatte, zur Polizei zu gehen. Sie würde es nicht über sich bringen, noch einmal in einem grauen, sterilen Vorzimmer zu sitzen, mit einer netten Polizeibeamtin, die ihr geduldig erklärte, dass keine Fahndung ausgeschrieben werden, nicht mal ein Vermisstenfall angelegt werden konnte. Kein Hinweis auf eine Straftat. Elli war vierzehn gewesen, als sie all ihren Mut zusammengekratzt hatte. Sie erinnerte sich noch an ihre juckenden Achseln und die brennenden Wangen, während sie die Geschichte ihrer großen Schwester erzählte, deren Unzufriedenheit man erst spürte, wenn man nah genug stand, um sie abzukriegen. Lou, die immer auf der Suche gewesen war. „Sie ist so unglücklich“, war Elli herausgeplatzt. „Niemand wusste es. Ich glaube, es hat auch niemanden interessiert.“
Eine Träne lief Elli über die Wange, als der Zug in den Bahnhof Cuxhaven einfuhr. Eine Träne für ihre Schwester, für die Jahre der Einsamkeit und des Unverstandenseins.
***
Vor dem Bahnhof warteten die Leute an Bushaltestellen. Einige Späturlauber waren darunter, standen mit ihren Taschen und Koffern unter künstlicher Beleuchtung. Der Seewind, der zwischen den Gebäuden hindurchfegte, ließ Elli in ihrem abgetragenen Steppmantel schlottern. Sie trug weder Handschuhe noch Schal und ihre Sneakers wussten diesem Wetter nichts entgegenzusetzen.
Der Elektrobus schob sich gemächlich durch enge Straßen. Rechts und links hübsch gestaltete Ferienhäuschen mit maritimen Namen. Haus Meereswoge. Haus Strandmuschel. Haus Waterkant.
Hin und wieder erhaschte Elli dazwischen einen Blick auf die Silhouette des in einiger Entfernung verlaufenden Deichs. Es waren kaum Fußgänger unterwegs, doch diejenigen, die Elli sah, trugen windfeste Anoraks, Stirnbänder und Goretex-Schuhe. Die Wolken hatten sich endlich ihrer Pflicht ergeben und feine Regentropfen klatschten gegen die Busfensterscheibe.
Die Haltestelle Duhner Strand lag auf einem kreisförmigen Platz aus rotem Stein. Nässe kroch Ellis Nacken hinunter, stahl sich in die Öffnung ihres Kragens. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite reihte sich ein Souvenirgeschäft ans nächste und der Platz selbst war gesäumt mit Restaurants und Cafés, ganz genauso wie vor fünfundzwanzig Jahren. Doch das Gedränge fehlte.
Manche Lokale hatten durchsichtige, beheizte Zelte aufgestellt, in denen die Gäste das Draußensitzen genießen konnten, ohne wirklich draußen zu sitzen, doch nur wenige nutzten das Angebot. Dieses Duhnen Anfang November, bei Regen und wenigen Graden über Null, hatte nichts mit dem Duhnen zur Hochsaison gemein. Stimmengewirr, Gelächter, Fahrradklingeln und das Klappern von Hufen auf Kopfsteinpflaster – all die Geräusche von damals waren einer gespenstischen Stille gewichen.
Ein paar Stufen nur und Elli war auf dem Deich, der an dieser Stelle eher flach verlief, angekommen. Hier standen Häuschen, die Strandkörbe vermieteten, doch nicht zu dieser Jahreszeit. Der Strand selbst erstreckte sich in beide Richtungen, so weit das Auge reichte. Er war mithilfe von knochigen Büschen in Segmente unterteilt worden. In manchen Teilstücken standen noch Strandkörbe, gelbe oder weiße, mit blau-gestreiftem Sonnenschutz und Zahlen an der Seite. Elli stieg die nächste Treppe hinab, bis sie Sand unter ihren Sohlen spürte. Langsam stapfte sie über den unebenen Untergrund, ein Fuß vor den anderen setzend, bis sie den Punkt erreichte, an dem der Boden nicht mehr unter ihrem Gewicht nachgab. Wellenförmiger Meeresboden, der sich bei Niedrigwasser in endlosen Weiten von der Küste aus wegzog, bis zu jenem Leitdamm aus Findlingen und Granit, der das Watt von der Schifffahrt trennte. Im Moment war das Meer noch zugegen, hatte seinen Rückzug gerade erst begonnen. Elli hörte sein Rauschen und erkannte das Glitzern der Wasseroberfläche. Ungefähr sechs Stunden vergingen zwischen Hoch- und Niedrigwasser, zwischen dem Lecken der Wellen am Strand und der endlosen Weite des Watts.
Hast du mich endlich gefunden?
Elli war, als reiße die nächste Windböe besonders nachdrücklich an ihr, als trage sie die Stimme ihrer Schwester mit sich, die sonst nur in ihrem Kopf widerhallte: Du hast ja lange genug gebraucht.
Elli kniff die Augen zusammen, stierte in die Richtung, in der der Horizont liegen musste. Weder Mond- noch Sternenlicht drang durch den zugezogenen Himmel. Es hatte keinen Zweck. Die Insel war nicht zu sehen.
***
Sie musste unbedingt hinüber.
Ein Kribbeln hatte Ellis Körper erfasst, machte es ihr unmöglich, still zu stehen. Sie konnte nicht bis morgen warten. Ihr fiel nur ein einziger Ort ein, wo sie um Hilfe bitten könnte.
Elli setzte sich in Bewegung, lief an Souvenirgeschäften, Restaurants und einem kioskartigen Krämerladen vorbei. Sie nutzte die Chance und kaufte schnell zwei Mal Unterwäsche und eine Zahnbürste. Bereits im Weitergehen stopfte sie alles in ihren Rucksack.
Als sie den Platz erreichte, auf dem das flache, glaswandige Gebäude stand, beschleunigten sich ihre Schritte. Hier war sie mit ihren Eltern und Lou gewesen, um nach den Wattzeiten zu fragen und Broschüren zu Ausritten und Schifffahrten mitzunehmen: Die Touristeninformation. Elli rannte jetzt. Keuchend erreichte sie die Tür.
Geschlossen.
Aber war das nicht … Elli trat ans Glas, so dicht, dass ihre Nasenspitze dagegen stieß. Sie hatte sich nicht getäuscht. Ein kleines Licht brannte im Inneren. Jemand war noch da. Elli klopfte an, sah eine Gestalt, deren Umrisse größer und deutlicher wurden, bis sie direkt in ein Frauengesicht blickte. Die Dame lächelte so breit, dass sich tiefe Falten in die ledrige Haut rund um Mund und Augen gruben.
Ein Schlüsselbund klapperte, dann öffnete sich quietschend die Tür. „Kann ich helfen?“ Die Frau streckte ihren Kopf zur Tür hinaus. Dicke Regentropfen fielen auf den mausgrauen Haarschopf, zogen nasse Bahnen an ihren Schläfen entlang und verschwanden im Kragen des Wollkleides. Die Frau schien es nicht zu bemerken. „Suchst du ein Zimmer?“, half sie nach. Ihr Alter war schwer einzuschätzen. „Oh, du Arme, bist du hier etwa gestrandet? Und bei diesem Wetter auch noch.“
„Ich muss auf die Insel.“
„Oh …“, machte die Frau. „Welche Insel denn? Die Katamarane nach Sylt und Helgoland fahren von der Alten Liebe aus, das ist drüben in der Nähe des Hauptbahnhofs.“
„Ich meine die Insel da draußen im Watt, die man wegen des Wetters gerade nicht sehen kann.“
„Neuwerk.“
Der Name durchzuckte Elli wie ein Elektroschock. „Genau.“
„Bedauere, aber die Fähre dorthin verkehrt nur von April bis Oktober. Dasselbe gilt für Wattwagenfahrten. Im Herbst und Winter ist das Watt zu unberechenbar und die Strecke beträgt immerhin zwölf Kilometer. Ich versichere dir, dass da drüben zu dieser Jahreszeit ohnehin nichts los ist. Wie wäre es stattdessen mit einer Strandbahnfahrt? Oder ein Besuch im Schloss Ritzebüttel? Dort gibt es eine wunderhübsche Dauerausstellung zum Thema …“
„Sie verstehen nicht. Ich …“ Elli riss ihr Handy aus der Jackentasche und ließ es beinahe fallen. „Ich suche dieses Mädchen. Ihr Name ist Yasmin. Ich glaube, dass sie auf Neuwerk ist.“
Die Dame zog die Brauen zusammen, als sie Yasmins Foto studierte. Sie schüttelte entschuldigend den Kopf. „Ist sie eine Freundin von dir?“
„Die Freundin einer Freundin. Sie ist seit einer Woche verschwunden und über Social Media haben wir den Hinweis erhalten, dass Yasmin in die Bahn von Bremerhaven nach Cuxhaven gestiegen ist.“
Die Dame hörte zu, während ihr der Regen vom Kinn tropfte. Das Lächeln war erloschen. „Und wie kommt ihr gerade auf Neuwerk?“
Elli schluckte. „Weil meine Schwester ebenfalls verschwunden ist.“ Sie spürte die wachen Augen auf sich, wusste, dass weitere Erklärungen nötig waren, um die Frau davon zu überzeugen, ihr zu helfen. Aber Elli wusste auch, wie es klingen würde. Sie ist seit neunzehn Jahren verschwunden und erst jetzt ist mir eingefallen, dass sie von Neuwerk ganz besessen war. Das, und sie hat dieselben Abschiedsworte wie Yasmin verwendet.
Elli räusperte sich, kämpfte gegen den Kloß in ihrem Hals an. Es gab einen Zusammenhang. Nur würden Außenstehende das nicht so leicht begreifen. „Ihr Name ist Lou“, sagte sie nur. „Ich muss auf die Insel. Bitte.“
Elli sah das Kopfschütteln, das mitleidige Kräuseln der Mundwinkel und ihr kam es so vor, als säße sie noch im Zug und fahre in einen Tunnel. Die Regen- und Windgeräusche drangen nur noch gedämpft an ihre Ohren.
„Es tut mir so leid, dich zu enttäuschen.“
„Es … gibt wirklich keinen Weg hinüber?“
Die Frau schüttelte den Kopf.
Elli starrte sie an. Ein simples Nein, ohne Wenn und Aber, das alles veränderte. Waren es Tränen, die ihr über die Wangen liefen oder nur Regentropfen?
„Möchtest du hereinkommen und mir alles in Ruhe erzählen? Ich bin Dörte.“ Die Dame trat zur Seite, gab den Weg ins Innere frei. „Ich mache uns Tee. Original Ostfriesentee mit Kandis. Wie heißt du denn eigentlich?“
„Elli.“ Sie straffte ihren Körper, zwang sich, der netten Dame ins Gesicht zu blicken. „Danke für Ihre Hilfe.“
So schnell gibst du auf, Elli-Schmelli?
Sie wandte sich ab, lief blind zurück zur Straße. Bevor sie um die Ecke bog, sah sie sich noch einmal um.
Dörte stand in der Tür und schaute ihr hinterher. In der Dunkelheit konnte Elli es nicht genau erkennen, doch es sah so aus, als würde sie telefonieren. Die Frau hob ihre freie Hand und winkte.
Elli reagierte nicht.
Da setzte Dörte sich in Bewegung, trabte mit schnellen Schritten auf sie zu, das Handy mit erhelltem Bildschirm in der Rechten.
„Wie wichtig ist es dir, nach Neuwerk zu kommen, Elli?“ Das kurze Haar klebte in tropfnassen Strähnen an ihren Schläfen und auf ihrem Wollkleid perlte der Regen. Dörte machte noch einen Schritt auf sie zu. Sie war nah, zu nah. Die kleinen Augen bohrten sich in Ellis. „Ich wüsste da eventuell doch eine Möglichkeit.“
Kapitel 3 – Anna
Sie wusste nicht, wie lange sie schon im Turm saß. Jeden Morgen stellte der Mann ihr einen an zwei Stellen gesprungenen Porzellanteller auf den Fußboden. Das Graubrot schmeckte einige Tage lang zu feucht, klebte in ihrem Mund als zähe Masse, bevor es trocken und spröde wurde und bei jedem Bissen in tausend Krümel zerfiel. Einmal die Woche kaufte er frisches Brot und es ging von vorne los. Er wechselte faden Käse mit zu salzigem Schinken ab, darunter stets eine dicke Schicht Margarine, die Übelkeit in Anna auslöste. Am Abend gab es Eintopf. Eine dicke, braune Pampe mit matschigen Kartoffeln, Rüben und klitzekleinen Stückchen Speck. Manchmal auch kleingeschnittene Wurst, aber stets Kartoffeln. Die Essensreste steckten zwischen ihren Zähnen und sie machte sich nicht die Mühe, sie zu entfernen. Die Margarine und die fettige Fleischbrühe legten sich Schicht um Schicht auf ihre Zunge, bis sie nichts mehr schmeckte. Ihre Finger stanken nach Urin, die dünne Wolldecke nach Schweiß. Ihr Kopf juckte von den Schuppen.
Anna fiel auf, dass die Tage kürzer wurden, weniger Stunden, in denen Tageslicht durch die schmalen Fenster drang, mehr Zeit in der Finsternis. Die Kälte wurde zum Problem, aber sie konnte ihn nicht um mehr Kleidung und um zusätzliche Decken bitten, denn sie hatte noch kein Wort zu ihm gesagt und hatte sich geschworen, es niemals zu tun.
Es störte ihn.
Doch mit ihr zu reden war nicht alles, was er wollte. Dieses andere, das Unaussprechliche, Undenkbare schwamm ebenfalls in seinem Blick, schleimig und ekelerregend, wie ein toter Fisch an der Tümpel-Oberfläche.
Worauf wartete er?
Das Licht wich zurück, war beinahe komplett verschwunden und zuverlässig wie jeden Tag hörte sie seine Schritte auf der Leiter, das dumpfe Wumm, wumm, wumm eines Mannes, der nicht in der Lage war, selbst verursachten Krach wahrzunehmen. Die Luke schwang auf, das Tablett wurde auf dem Boden abgesetzt.
„Hier.“ Erwartungsvoll wie ein Welpe, der auch nach zehn oder zwanzig Fußtritten schwanzwedelnd auf sein Herrchen zuläuft, setzte er sich Anna gegenüber. Es dauerte einen Moment, bis er die langen Gliedmaßen zum Schneidersitz gefaltet hatte. „Dein Essen.“
Selbst, wenn sie gewollt hätte: Niemals könnte ihr Körper Nahrung aufnehmen, während er so dasaß und sie anstierte. Sie wartete. Wünschte, sie hätte den Schneid, ihm in die Augen zu sehen. Stattdessen starrte sie zu Boden, auf den Punkt direkt jenseits ihrer Matratze, wo sich Krümel und andere Essensreste sammelten und Ameisen anlockten. Jetzt würde er gleich die Geduld verlieren und gehen. Und sie würde sich auf den Fraß stürzen, als sei es ihre Leibspeise.
„Essen“, wiederholte er.
Etwas stimmte nicht.
Anna riskierte einen Blick. Die tiefliegenden Augen hatten sich verdunkelt. Er stand auf, doch machte keine Anstalten zu gehen.
Anna rollte sich zu einer Kugel zusammen, die Knie stießen gegen ihre Rippen. „Bitte“, wimmerte sie.
Das Tablett krachte gegen die Wand, es regnete Scherben und Suppe. Dann war er über ihr. „Du solltest mir danken!“ Speicheltröpfchen klatschten ihr ins Gesicht. „Ich habe dich gerettet! Wieso tust du das?“
Ihre Augen schlossen sich von selbst. Die Grenzen von Realität und Albtraum verschwammen und später konnte Anna nicht sagen, welche der Geschehnisse dieser Nacht sie tatsächlich erlebt hatte und welche ihrer verdorbenen Fantasie entsprungen waren.
***
Sie hatten sie Anna genannt, damals, vor ihrem Leben im Turm. Es war ein Allerweltsname mit einem ganzen Haufen an Bedeutungen, die sie in der Bibliothek nachgeschlagen hatte; dumme, substanzlose Adjektive, mit denen Väter und Mütter allzu gern ihre Töchter betiteln wollten wie anmutig, barmherzig, liebreizend. Nichts davon traf auf sie zu, doch ihre Mutter hatte darauf bestanden, sie so zu nennen.
In jener Nacht, nachdem der Mann endlich gegangen war, träumte sie zum ersten Mal von früher. Was einigermaßen seltsam war, denn sie träumte mit offenen Augen. Sah das Mädchen, von dem alle dachten, dass sie es gewesen sei: Brav, folgsam, lächelnd. Eine Person, die sie in Wirklichkeit niemals sein konnte. Anna, das Scheinmädchen.
Als der Mann am nächsten Morgen wieder in den Turm kam, die Luke so fest auf den Boden krachte, dass alles vibrierte, träumte sie gerade von ihrem fünften Geburtstag. Sie hatte mit dem Nachbarsmädchen Esther im Garten gespielt und nach Würmern gesucht.
„Meiner ist länger“, sagte das Nachbarsmädchen in Annas Traum grinsend. Erde klebte in ihrem Gesicht und an den blonden Locken.
Anna besah sich Esthers Wurm, dann ihren eigenen, der hilflos auf ihrer Hand zuckte. Sie ließ ihn nach unten baumeln, hielt ihn direkt neben Esthers zum Vergleich. Es stimmte.
Sie griff nach dem anderen Ende ihres Wurms und zog.
„Hör auf, du tust ihm weh!“, rief Esther.
Ihr Gesichtsausdruck war zum Schießen. Ein Lachkrampf ergriff von Anna Besitz und Tränen rannen ihr über die Wangen, sodass sie den Wurm, der immer länger und dünner wurde, nur noch verschwommen sah. In diesem Moment riss er in der Mitte durch und sie hatte eine Hälfte in jeder Hand. „Ich wette, wenn ich sie aneinanderhalte, sind sie länger als dein Wurm“, japste sie.
Esther starrte auf die beiden, sich windenden Teile. Dann kam der erste Schluchzer. Viel zu laut durchschnitt er die Vorortstille. Die Eltern würden sie hören.
Annas Blick suchte wild umher und blieb an einer kleinen Gartenharke hängen. Das feuchte Metall lag kühl in ihrer Handfläche, als sie ausholte. Einen Augenblick lang war alles still, bevor Esther zu kreischen begann.
***
„Es ist nicht deine Schuld“, sagte Annas Mutter am nächsten Tag, als der Vater ihr erlaubt hatte, Anna in ihrem Zimmer zu besuchen. Ihre Mutter schob vorsichtig das karierte Kleidchen hoch, das Anna noch immer trug und betrachtete die Striemen, die der Gürtel des Vaters auf ihrem Rücken hinterlassen haben musste. Nicht ein einziges Mal berührten die Finger der Mutter dabei Annas Haut. Manchmal dachte sie zurück, lange, lange in die Vergangenheit, als sie drei oder vier gewesen war und versuchte, sich zu erinnern, ob ihre Mutter sie damals berührt hatte. Sie konnte sich an kein einziges Mal erinnern.
„Das wird schnell verheilen.“ Ihre Mutter sah sie aus traurigen, braunen Augen an. „Willst du nicht wissen, wie es Esther geht?“
Anna nickte zögerlich, obwohl das Nachbarsmädchen ihr egal war. Die Zuneigung ihrer Mutter war es nicht, auch wenn sie sich das selbst manchmal einzureden versuchte.
Ihre Mutter seufzte. „Nun, es ist ein Glück, dass du ihr Auge verfehlt hast. Der Doktor sagt, es sind nur Kratzer und es dürften keine Narben zurückbleiben.“ Ihre Finger wanderten unter die dicke graue Strickjacke, an die Stelle, wo sich die Umrisse eines Kreuzanhängers ganz leicht abzeichneten. Ihr Vater würde es nicht bemerken.
Mit geschlossenen Augen tat die Mutter ein paar tiefe Atemzüge. „Du bist gut, so, wie du bist, Anna. Der Herr hat seinen eigenen Plan, den kein Mensch auf Erden durchschauen kann. Er hat einen Grund gehabt, dich so zu machen, wie du bist.“ Anna erinnerte sich, dass sie vor langer, langer Zeit, als sie drei oder vier Jahre alt gewesen war, diesen Worten geglaubt hatte. Dann war ihr die Leere in der Stimme ihrer Mutter aufgefallen und dass sie Anna nie ansah, wenn sie das sagte. Und sie hatte begriffen, dass ihre Mutter selbst nicht daran glaubte.
***
Viel später, sie war gerade in der zweiten Klasse gewesen, kam das Verständnis, dass es nicht der autoritäre Vater war, der ihrer Mutter das Glück geraubt hatte, sondern Anna. Die Sache mit Esther war nicht ihr erstes Vergehen und sollte nicht ihr letztes bleiben. Weder die Schläge des Vaters noch die bedeutungslosen Worte der Mutter konnten sie davon abhalten. Dabei war es nicht so, dass sie es absichtlich tat. Es passierte einfach.
Die schlimmsten Tage waren die, wenn ihr Vater beruflich verreiste und ihre Mutter sie heimlich in die Kirche mitnahm. Wenn alle still beteten und zu Boden blickten, hallten die Worte des Vaters in ihren Ohren – wehleidiges, lamentierendes Pack – und der hohe, kalte Raum schien Anna zu ersticken. Die schmucklosen Wände, die Holzbänke und das lebensgroße Kreuz ganz vorne umzingelten sie und trieben sie in die Enge. Der Pfarrer starrte sie aus seinen misstrauischen Augen an. Wie viel hatte ihre Mutter ihm verraten?
Anna wusste, dass sie um Vergebung bitten sollte … für den Wurm, die Spinnen, die Katze des Nachbarn, Esther und für Thilo, der in derselben Straße wohnte, und über dessen Finger sie mit dem Fahrrad gefahren war, als er gerade einen Handstand versucht hatte.
Anna kannte die Bibel, hatte einige Stellen sogar ganz allein gelesen. Für jemanden wie sie war kein Platz in Gottes Armen. Doch obwohl sie entschieden hatte, nicht an Gott zu glauben, echoten die Worte der Mutter in ihr wider: Der Herr hat einen Plan. Er hat einen Grund, dich so gemacht zu haben, wie du bist.
***
Ihre Mutter hatte sicher nicht damit gerechnet, dass der Name, den sie ihrer Tochter gegeben hatte – ihr erster Vorname, nicht der schwache Allerweltsname Anna – ebendiese einmal vor einem erbärmlichen Leben in Gefangenschaft bewahren würde. Gut, dass sie niemals wirklich Anna gewesen war, denn Anna hätte längst aufgegeben. Hätte sich mit ihrem neuen Leben abgefunden, den ganzen Tag apathisch auf ihrer Matratze gelegen, vielleicht die Kerben in den Holzdielen gezählt oder angefangen, mit den Spinnen zu sprechen, doch mit Sicherheit hätte sie sich nicht mitten in der Nacht durch das winzige Fenster zu quetschen versucht. Das karge Essen kam ihr nun zugute, doch Knochen schrumpften leider auch durch Mangelernährung nicht. Das Problem war die Hüfte und die Schultern. Ihre Beine hingen bereits die Außenwand des Turms hinunter und zum Glück gab ihr der Fenstervorsprung die Möglichkeit, sich mit den Armen abzustützen, während sie vor Anstrengung keuchend drückte und schob. Der poröse Stein schnitt in ihre Oberschenkel und in den Bauch, denn sie hatte alles bis auf die Unterwäsche ausgezogen. Das wenige Fleisch, das sie noch am Hintern hatte, wurde gequetscht, bis sie schreien wollte, dann war ihre Hüfte plötzlich durch. Nun steckte ihr Oberkörper im Fenster fest. Sie konnte nicht atmen. Die schmale Öffnung im Stein ließ ihrem Brustkorb keinen Raum. Panisch versuchte sie, zurück in die Kammer zu kriechen, doch ihre Füße fanden keinen Halt. Sie würde hier sterben. Die Umrisse ihrer Matratze, ihres Nachttisches verschwammen vor ihren Augen. Mit letzter Kraft presste sie ihre Handflächen gegen den Fenstersims und drückte, so fest sie konnte, aber ihre Schultern wollten einfach nicht hindurch passen. Halb besinnungslos drang ein Geräusch an ihr Ohr und etwas in ihrer Schulter gab nach. Ihr rechter Arm bog sich in einem unnatürlichen Winkel und während sie sich noch fragte, wo sie die Kraft hergenommen hatte, überschwemmte sie der Schmerz und dann das surreale Gefühl zu fliegen.
***
Der Mann war es gewesen.
Er hatte sie gehört oder vom Haus aus gesehen, jedenfalls hatte er versucht, sie wieder reinzuziehen und, als das nicht ging, hatte er sie mit Gewalt durch das Loch in der Mauer gestoßen. Hatte sie vor dem Ersticken bewahrt und ihr gleichzeitig die Schulter ausgekugelt. Den Sturz selbst und den damit einhergehenden Beinbruch hatte sie sich selbst zuzuschreiben, sagte er, bevor er ihren Arm zu drehen und zerren begann, dass ihr Sterne vor den Augen tanzten. Als ihre Kehle vom Schreien heiser war, doch der Schmerz in ihrer Schulter etwas nachgelassen hatte, musste sie ihm insgeheim recht geben.
Sie war selbst schuld.
Obwohl er ihr Bein schiente, wälzte sie sich tagelang im Schmerzdelirium hin und her. Und begriff zuerst gar nicht, was er in ihrer Kammer tat. Er war jetzt viel öfter da, verursachte laute Geräusche, die sie aus ihrem so dringend benötigten Schlaf rissen. Ein Schaben und Poltern, Klopfen und metallenes Rasseln. Zwischendurch brachte er ihr widerlich schmeckenden Sud, der nur bedingt gegen die Pein half, doch es ihr zumindest ermöglichte, für eine Weile aus der Realität zu entrücken.
„Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Ich hätte besser auf dich achtgeben müssen.“
Das Bein machte noch lange Probleme. Selbst, als die Schwellung bereits verschwunden war, tat jede Bewegung weh, insbesondere, als er ihr nicht mehr regelmäßig den Sud brachte.
„Du darfst ihn nicht zu lange trinken, hat meine Mutter immer gesagt. Irgendwann kannst du nicht mehr ohne.“
Anna wunderte sich, wieso es die ganze Zeit über so dunkel war. Es konnte noch nicht Winter sein. Dann fiel ihr auf, dass sie keine Zugluft mehr spürte. Sie wusste nicht, wie viel Zeit seit ihrem Sturz vergangen war, als sie sich das erste Mal bewusst umsah und etwas anderes wahrnahm als ihre Schmerzen. Er hockte gerade auf dem Boden und stellte das Tablett ab. Suppe. Es musste also Abend sein, doch das Licht, das in letzter Zeit nur mit seiner Anwesenheit kam und ging, war zu gelb. Es rührte von einer Laterne her, in der eine Stumpenkerze brannte. Die Fenster gab es nicht mehr. An ihrer Stelle saßen zwei kleine Quadrate aus braunen Backsteinen, perfekt in die vormaligen Fensteröffnungen eingepasst.
„Du weißt nicht, wie es dort draußen ist“, sagte er an ihrem Ohr. „Sie sind verdorben, allesamt. Aber unsere Insel gibt auf dich acht. Ich gebe auf dich acht. Deswegen hab ich dich doch mitgenommen. Damit du dir nicht selbst schadest.“
Auch der Eisenring am Boden war neu. Sein Zweck erschloss sich Anna erst, als die kupferne Kette hindurchgeführt und die uneinheitlich geformten Riemen an ihren Enden um ihre Handgelenke geschlungen wurden. Selbst, wenn es die Fenster noch gäbe, selbst, wenn sie es irgendwie schaffen könnte, das Schloss an der Luke zu öffnen – sie hatte kaum genug Bewegungsspielraum um von ihrer Matratze aufzustehen. Anna verbrachte ihre Tage fortan auf dem Rücken liegend, die Arme nach oben neben ihrem Kopf ausgestreckt, da ihr sonst das rostige Metall in die Haut schnitt. Und je weniger die Schmerzen in ihrem Bein wurden, desto mehr dachte sie über alles nach und begriff, wie dumm sie gewesen war.
Eine Insel.
Vielleicht steckte doch mehr von Anna in ihr, als sie sich eingestehen wollte. Denn nur Anna hätte den feigen Plan einer Flucht gefasst, anstatt sich der Realität zu stellen. Die Wahl zwischen Gefangenschaft und Freiheit hatte es nie gegeben.
Nun, da ihr das klar war, begriff sie auch, wieso ihr Blick von der Ecke des Nachttisches angezogen wurde. Manchmal träumte sie von Reiner, der in der dritten Klasse neben ihr gesessen hatte, sah ihn mit dem Loch im Kopf, wie das Blut über seine Schläfe rann und er sogar noch dümmlich grinste, als die Sanitäter ihn auf die Trage pressten. Niemand konnte oder wollte später sagen, was genau passiert war. War Reiner geschubst worden? Er überlebte, doch die Wucht – und das war das Entscheidende – mit der sein Kopf gegen die Ecke des Lehrerpults gekracht war, hätte ihn beinahe das Leben gekostet. Die Wucht, sagte sie sich wieder und wieder. Doch mit ihren angeketteten Händen konnte sie keinen Anlauf nehmen. Fallen wäre eine Möglichkeit, aber die Ecke war zu klein, um sicherzustellen, sie auch zu treffen. Viel wahrscheinlicher würde sie sich dabei ein Auge ausstechen oder das Ohr zerquetschen. Sie zitterte so heftig, dass ihre Ketten rasselten. War ihr Leben hier in der Kammer wirklich so schlimm? Wenn sie etwas netter zu ihm wäre, würde er ihr vielleicht etwas Besseres zu essen geben, noch ein paar Decken, frische Kleidung …
Sie sah Sternschnuppen, zumindest stellte Anna sie sich so vor. Grelle Lichtblitze, die die Finsternis erhellten. Wo war sie? Wieso schmerzte ihr Kopf so? Sie tastete mit den Fingern und merkte, dass sie auf dem Boden lag. Klebriges Nass in ihrem Haar, nur ein bisschen, gerade genug, um ihre Fingerspitzen zu befeuchten. Sie schaute hoch zu ihren Sternschnuppen und schloss die Augen.
Als sie das nächste Mal zu sich kam, war es hell. Er hatte wieder die Lampe dabei. Dieses Mal sagte er nichts. Er sah sie nur an und fuhr mit den dicken Fingern gedankenverloren über den Nachttisch, der keine Ecken mehr aufwies. Die Kante verlief nun in einem unregelmäßigen Bogen.
Gib endlich auf, flehte Anna. Doch das würde bedeuten, dass ihre Mutter recht gehabt hatte. Er konnte ihre Fenster zumauern, konnte alle Ecken in dieser Kammer abrunden, aber er konnte sie nicht zwingen zu essen.