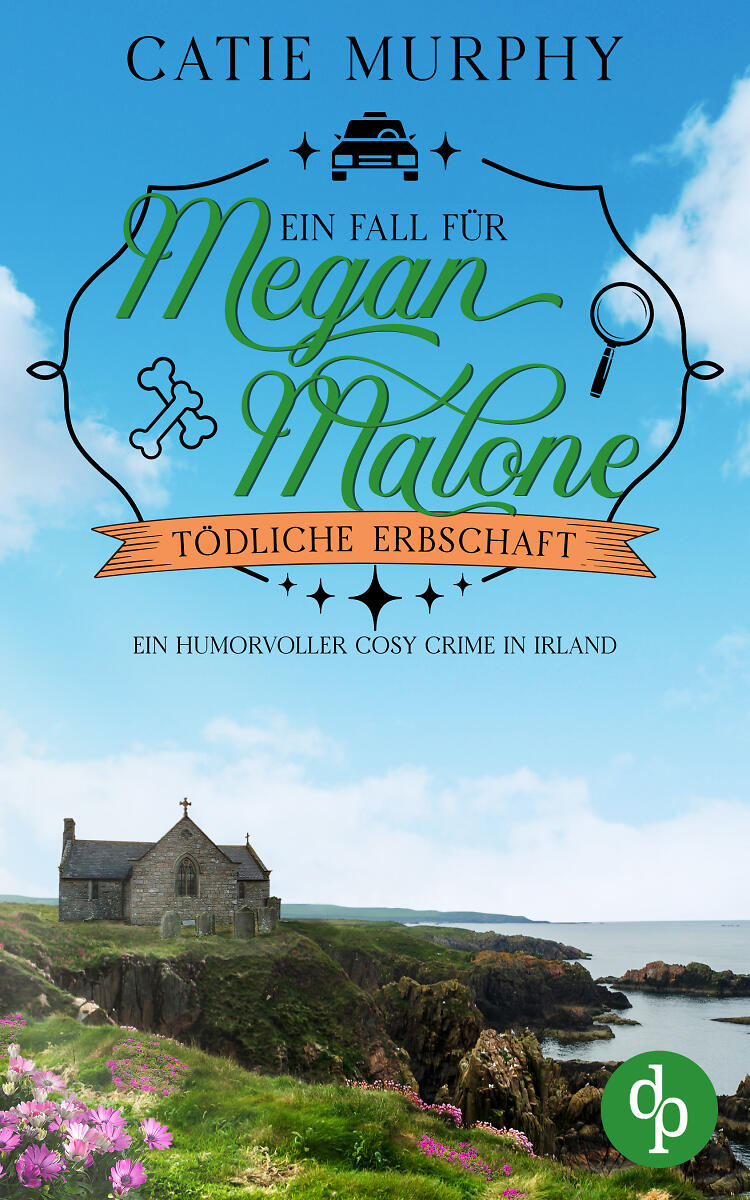Kapitel eins
Der Leichnam lag in einem Sarg, der gute fünfundvierzig Zentimeter zu kurz war. Um das Platzproblem zu lösen, hatte man dem Mann die Beine gebrochen und nach hinten geknickt.
Megan stand auf den Zehenspitzen und spähte mit einer Mischung aus Faszination und Horror in den Holzkasten. Die Leiche, die ›der Kreuzritter‹ genannt wurde, hatte durch den natürlichen Prozess der Mumifizierung eine staubgraue Farbe angenommen. Im Leben musste er ein wahrer Riese gewesen sein, ganz besonders, wenn man bedachte, wie klein der Durchschnittsmensch vor gut achthundert Jahren gewesen war. Wieso der Mann in der Krypta der St. Michan’s Church in Dublin seine letzte Ruhestätte gefunden hatte, entzog sich Megans Kenntnis.
Neben ihm stand ein besser passender Sarg mit einem weiteren Leichnam, der nicht nur beide Füße, sondern auch seine rechte Hand verloren hatte. Megan traute sich nicht recht zu fragen, ob er bereits auf diese Art zu Grabe getragen worden war oder ob seine Körperteile über die Jahrhunderte hinweg verloren gegangen waren. Da neben ihm allerdings das Skelett einer kleinen Frau lag, die als ›die Nonne‹ bezeichnet wurde, hielt es Megan für eher unwahrscheinlich, dass es jemand im altertümlichen, streng katholischen Irland gewagt hätte, in der Anwesenheit einer Frau Gottes Gliedmaßen zu klauen. Die Tatsache, dass der Mann hier unter der Kirche beerdigt worden war, ließ darauf schließen, dass er zu Lebzeiten ein anständiger Kerl gewesen sein musste, auch wenn er von dem Fremdenführer und auf den Plaketten in der Krypta als ›der Dieb‹ bezeichnet wurde. Der vierte und letzte Leichnam war eine Frau, die bloß ›die Unbekannte‹ genannt wurde, was, so fand Megan, irgendwie selbsterklärend war.
»War einer davon der Earl?« Die forsche amerikanische Frauenstimme wurde von den Kalksteinwänden der Gruft zurückgeworfen und hallte unangenehm in Megans Ohren wider. Da sie selbst aus Texas stammte und erst seit etwa drei Jahren in Irland lebte, kannte sie sich mit forschen Amerikanern aus. Cherise Williams passte ziemlich perfekt in diese Kategorie. Megan fuhr Mrs. Williams seit zwei Tagen durch Dublin und konnte die Grimasse des Fremdenführers, der für einen kurzen Moment angespannt die Zähne bleckte, durchaus nachvollziehen – dabei hatte der junge Mann gerade mal zehn Minuten mit ihrer Kundin verbracht.
So wie Megan es selbst bereits Dutzende Male getan hatte, verwandelte der Fremdenführer seine Grimasse in ein Grinsen und schüttelte den Kopf. »Nein, Ma’am, die Earls wurden zwar hier bestattet, aber sie befinden sich nicht unter den ausgestellten Mumien. Wie Sie sich vielleicht vorstellen können, könnte die Kirche es kaum gutheißen, die Särge aufzubrechen, um die Mumien zur Schau zu stellen. Bei denen, die wir hier sehen, handelt es sich um …«
»… Mumien aus Freilandhaltung?« Megan konnte sich nicht zurückhalten und nutzte das kurze Zögern des Mannes, um das Wort zu ergreifen.
Der arme Kerl, der vielleicht zwanzig Jahre jünger als Megan war, starrte sie schockiert an, und pures Entsetzen kroch über seine Züge. Während er versuchte, seine Mimik zu kontrollieren, realisierte Megan, dass er so erschrocken dreinsah, weil er Angst davor hatte, laut loszulachen.
»Ähm … nun ja, sozusagen«, brachte er schließlich halbwegs ernst hervor. »Freilandhaltung wäre zwar … Ja gut. Man könnte es so sagen. Ich würde zwar nicht unbedingt dieses Wort wählen, aber man könnte es so formulieren.« Er klang ein wenig, als würde er versuchen, sich selbst zu überzeugen. »Die Särge dieser Mumien sind über die Jahrhunderte auf den Boden gerutscht, wurden zersetzt oder anderweitig beschädigt. Und in diesen Fällen haben wir uns dazu entschieden …« Er warf Megan einen weiteren leicht entsetzten Blick zu, beschloss aber offenbar, ihre Analogie zu übernehmen. »Wir haben uns dazu entschieden, sie nicht wieder in Käfige zu sperren.«
»Aber ich brauche die DNA des Earls«, betonte Mrs. Williams in einem schrillen Tonfall.
»Ja, Ma’am, aber Sie verstehen doch hoffentlich, dass ich nicht einfach einen Sarg öffnen kann, nur weil ein Besucher das verlangt …«
»Gut, und was ist mit einem von diesen hier?« Mrs. Williams gestikulierte ungeduldig zunächst zur Wand, wo mehrere bröckelnde Särge in den Nischen und Gewölben untergebracht waren, und anschließend zum Boden, wo einige der alten Holzkisten dem Zahn der Zeit erlegen waren und hier und da mumifizierte Arme und Beine hervorragten.
»Ja, Ma’am, manche davon sind tatsächlich die Earls of Leitrim, aber …«
»Na, dann geben Sie mir doch ein Stück von denen! Ich brauche ja bloß eine Probe. Ist ja nicht so, als hätte ich vor, mit einem ganzen Skelett in meiner Handtasche hier rauszuspazieren. Seien Sie doch nicht so absurd, junger Mann.«
Der Fremdenführer warf Megan einen verzweifelten Blick zu. Sie antwortete mit einem Seufzen und trat einen Schritt näher an Cherise Williams heran. »Wir sollten uns lieber bald auf den Weg machen, damit wir es rechtzeitig zu Ihrem Termin um zwei Uhr schaffen, Mrs. Williams. Dem Termin, bei dem Sie mit den zuständigen Kirchenbeamten über diese Sache sprechen können anstatt mit einem Fremdenführer. Sie wissen doch, wie schwer es für junge Männer ist, zu Frauen Nein zu sagen. Wir möchten doch nicht, dass er Ärger bekommt.« Was Megan eigentlich sagen wollte, war, dass es jungen Männern schwerfiel, zu Frauen Nein zu sagen, die sie an ihre Mütter erinnerten, aber Cherise Adelaide Williams war gut darin, ihr wahres Alter von dreiundsechzig Jahren zu verbergen, und wirkte, als würde sie davon ausgehen, dass niemand sie für alt genug hielt, um einen zwanzigjährigen Sohn zu haben.
Mit einem Schlag wurde der Ausdruck des Fremdenführers weicher und mit strahlenden Augen schenkte er Mrs. Williams ein absolut gewinnendes Lächeln. Er bot ihr den Arm, den sie ohne zu zögern ergriff, und senkte die Stimme zu einem vertrauensvollen Murmeln. »Absolut, und sie hat völlig recht, Ma’am. Es bricht mir das Herz, den Schmerz in Ihren wunderschönen blauen Augen zu sehen, aber wenn ich diesen Job verliere, setze ich meine ganze Zukunft aufs Spiel. Sie wissen ja, wie das ist. Es stimmt zwar, dass die Universitäten in Irland nicht ganz so teuer sind, wie es in den Staaten der Fall ist, aber wenn man ein junger Mann ist, der sich ganz allein in der Welt durchschlägt, dann ist es teuer genug. Ohne das Wohlwollen der Brüder von St. Michan’s wäre ich völlig aufgeschmissen, und ich weiß, dass eine so reizende Dame wie Sie niemals wollen würde, dass ein junger Mann alles verliert.« Er eskortierte sie zur Treppe und ging dann mit ihr nach oben, wobei sie sich beide ducken mussten, um durch den Steinbogen zum Friedhof zu gelangen. Während sie die Treppen nach oben gingen, setzte der Junge einen breiten irischen Akzent auf und legte sich derartig ins Zeug, dass Megan den Drang verspürte, die Füße etwas höher als sonst zu heben, um nicht auf seiner Schleimspur auszurutschen.
Als sie durch die stählernen Kellertüren ins Freie trat, hatte der Fremdenführer Mrs. Williams so sehr um den Finger gewickelt, dass sie lächelnd mit den Wimpern klimperte. »Wir haben doch noch eine Minute Zeit, nicht wahr?«, flötete sie in Megans Richtung. »Peter würde mir gern noch das Innere der Kirche zeigen. Vielleicht kann ich ja einen Pastor überreden, mir einen Fingerknochen oder so was in der Art zu geben, dann könnte ich mir diesen ganzen bürokratischen Nonsens sparen.«
Megan beobachtete den jungen Fremdenführer, der sich offenbar verkneifen musste, Mrs. Williams darüber zu informieren, dass man die Geistlichen in Irland nicht Pastor, sondern Priester nannte. Er legte dabei eine erstaunliche Selbstbeherrschung an den Tag.
Megan nickte schließlich. »Natürlich, Mrs. Williams.« Megan konnte sich zwar nicht vorstellen, dass dieses Szenario tatsächlich eintreten würde, aber sie folgte dem Schmeichler und der Geschmeichelten in die Kirche.
Teile der St. Michan’s Church sahen von außen herrlich alt aus. Das Fundament stammte aus der Zeit, in der die Wikinger in Dublin ihre Siedlungen errichtet hatten, und ein Turm und Teile des Kirchenschiffs hatten seit dem siebzehnten Jahrhundert überlebt. Mit ihren unregelmäßigen grauen Steinen und dem groben Mörtel sah man ihnen ihr Alter auch deutlich an. Der Rest des Kirchenschiffs war mit Betonblöcken repariert worden, die Megan an den Baustil der 70er-Jahre erinnerten, obwohl sie angeblich bereits Anfang des 19. Jahrhunderts gesetzt worden waren. Megan erwartete, dass die Kirche von innen ebenfalls historisch aussah, doch die sauberen, cremefarbenen Wände und die dunklen Kirchenbänke sahen genauso modern aus, wie sie es aus den Kirchen in ihrer Heimat kannte. Das Licht fiel durch bogenförmige Buntglasfenster, und die Orgel, auf der Georg Friedrich Händel, der Komponist des berühmten Oratoriums Der Messias, angeblich höchstpersönlich gespielt hatte, dominierte das eine Ende des Kirchenschiffs. Es war ein starker Kontrast zu den engen Gängen und verstaubten Winkeln der Krypta und Megan musste überrascht den Kopf schütteln.
Aber so war Dublin – das hatte sie in den Jahren, die sie bereits in dieser Stadt lebte, langsam gelernt. Moderne Gebäude wurden auf historischen Stätten errichtet und jedes Mal, wenn ein neues Bauprojekt gestartet wurde, waren die Arbeiter ewig damit beschäftigt, die Überreste der alten Wikingersiedlungen freizulegen. Selbst diese etwa dreihundert Jahre alte Kirche war über der alten, ursprünglichen Kapelle gebaut worden, die hier vor tausend Jahren errichtet worden war, und in den Büchern stand, dass sich selbst fünfhundert Jahre davor bereits geweihter Boden an dieser Stelle befunden hatte.
Etwa zur gleichen Zeit, in der in Irland St. Michan’s erbaut worden war, waren in den USA alle Tempel oder ähnliche alte Stätten dem Erdboden gleichgemacht und die Menschen, die sie frequentiert hatten, ermordet worden.
»Was für ein heiterer Gedanke«, murmelte Megan leise. Der Fremdenführer Peter hatte Mrs. Williams inzwischen dem Priester vorgestellt, der dreinsah, als wäre er ein Mann, der einem Sturm trotzen musste. Dabei lehnte er sich Mrs. Williams regelrecht entgegen, als müsste er ihrer Hartnäckigkeit körperlich Widerstand leisten, und hätte er mehr Haare gehabt, hätten diese vermutlich dramatisch im Wind ihres Ansturms geweht – zumindest konnte sich Megan das bildlich vorstellen. Der Mann war vermutlich in seinen Siebzigern und hatte einen schlanken, drahtigen Körperbau. Ein kurzer Bart wuchs auf seinem breiten Kiefer, der aussah, als hätte sein Besitzer schon in unzähligen wichtigeren Diskussionen die Stellung gehalten.
»… Großvater, der Earl of Leitrim …« Cherise Williams bestand darauf, die irische Grafschaft wie Leitrum auszusprechen, auch wenn sie eigentlich wie Litrim klingen sollte. Obwohl Megan selbst aus Texas stammte, konnte sie nicht eindeutig sagen, ob Williams einfach nicht wusste, wie das Wort richtig ausgesprochen wurde, oder ob ihr Akzent sich schlicht und ergreifend verselbstständigte. Zwar hatte jede Person, die bis jetzt mit dem Wort Leitrum konfrontiert worden war, den Ort in ihrer Antwort korrekt als Litrim ausgesprochen, doch obwohl die Menschen dabei für gewöhnlich immer deutlicher und lauter wurden, waren sie bislang zu höflich gewesen, um Mrs. Williams auf ihren Fehler aufmerksam zu machen. Bis jetzt hatte keiner der Korrekturversuche gefruchtet und Megan vermutete stark, dass die andere Texanerin gar nicht bemerkte, dass sie das Wort anders aussprach als die Menschen um sie herum.
»Ihr Urgroßvater?«, unterbrach der Priester mit unverhohlener Überraschung, woraufhin Mrs. Williams lächelte und die Hand ausstreckte, als würde sie einen Kuss darauf erwarten.
»Das ist korrekt. Ich bin die Erbin der Grafschaft Leitrum.«
Der Fremdenführer und der Priester sahen gleichzeitig ungläubig zu Megan, während Mrs. Williams mit den Wimpern klimperte. Megan weitete zur Antwort unschlüssig die Augen und zuckte mit den Schultern. Noch vor einer Woche hatte sie keine Ahnung gehabt, dass es in Leitrim (oder überhaupt irgendwo in Irland, um genau zu sein) jemals Earls gegeben hatte. Dann hatte Mrs. Williams, die sich selbst als Countess Williams bezeichnete, bei Leprechaun Limos, dem Fahrservice, für den Megan arbeitete, einen Wagen mit Fahrerin gemietet. Megans Chefin, die vermutlich die am wenigsten leichtgläubige Person war, die Megan je getroffen hatte, hatte die selbst ernannte Adlige beim Wort genommen und ihr das Dreifache des üblichen Preises berechnet. Megan hatte seither die Earls von Leitrim recherchiert, und seit sie Mrs. Williams vom Flughafen abgeholt hatte, hatte sie deren eigene Erklärung schon etliche Male mit anhören müssen. Auch in diesem Moment fing sie wieder damit an und zog mit ihrer Märchengeschichte die Aufmerksamkeit des Priesters und des Fremdenführers auf sich zurück.
»… habe meinen Urgroßvater natürlich nie gekannt und mein Großvater ist im Krieg gestorben, aber seine Frau, meine Oma Elsie, die hat mir immer Geschichten über Urgroßvater erzählt, denn sie hat ihn zu Lebzeiten gekannt. Sie sagte, er hätte einen ausgeprägten irischen Akzent gehabt und immer Geschichten darüber erzählt, dass er der Sohn eines Adligen sei. Als wir Kinder waren, haben wir immer Ritter und Prinzessin gespielt, denn wir waren uns sicher, dass in unseren Adern das Blut eines Königs fließt.« Sie steckte die Hand in ihre Umhängetasche, die groß genug war, um dem gesamten Fort Alamo Platz zu bieten, und zog ein kleines Buch hervor. Die vergilbten Seiten waren alt und dick und der verblasste Stoffeinband war mit einem blauen Blumenmuster verziert und wurde durch ein angelaufenes Goldschloss zusammengehalten. Der Schlüssel dazu hing an einem dünnen, blassroten Band, das zwischen die Seiten gesteckt worden war. Mrs. Williams zog es geschickt hervor, um das Buch zu entriegeln. Sie öffnete die zerlesenen Seiten und präsentierte sie dem Priester und dem Fremdenführer. Die beiden Männer hatten eindeutig keine Ahnung, was man ihnen da unter die Nase hielt – und interessierten sich in Wahrheit wohl auch nicht dafür.
»Meine Großmutter Elsie hat die ganze Sache nie wirklich ernst genommen, aber nach ihrem Tod haben wir das hier bei ihren Sachen gefunden. Da drinnen stehen die ganzen Geschichten, die mein Urgroßvater Patrick ihr erzählt hat, inklusive der Tatsache, dass er der Earl of Leitrum war. Sie hat gesagt, dass er nicht mehr nach Irland zurückkehren wollte, weil es dort nur Ärger gab, aber das war damals und jetzt ist jetzt, nicht wahr? Ich brauche also bloß ein Stück von den Knochen eines der alten Earls, damit ich beweisen kann, dass ich mit ihnen verwandt bin, verstehen Sie?«
»Und was ist mit Ihrem Vater?«, fragte der Priester wie gegen seinen Willen.
In Cherise Williams’ Gesicht bildeten sich tiefe Falten, die zu Furchen in ihrem Make-up wurden und ihre Mundwinkel nach unten zogen. »Mein Daddy ist schon vor langer Zeit gestorben und hat den Namen der Edgeworths mit sich ins Grab genommen. Hätte ich gewusst, was für eine Bedeutung dieser Name hat, hätte ich ihn natürlich behalten, aber als ich geheiratet habe, habe ich den Nachnamen meines Mannes angenommen. Das war damals so üblich. Aber meine Mädchen und ich, wir sind die letzten lebenden Vertreter der Edgeworth-Blutlinie. Meine mittlere Tochter Raquel kommt heute Nachmittag an und wird mir bei dieser ganzen Sache zur Seite stehen. Wir wollten eigentlich zusammen fliegen, aber sie hatte einen Notfall auf der Arbeit.« Sie richtete ihre traurigen blauen Augen auf Megan, die sich daraufhin wunderte, dass ihre Auftraggeberin sich an ihre Existenz erinnerte. »Ms. Malone wird sie vom Flughafen abholen, während ich mich mit den Leuten von Vital Statistics unterhalte, damit ich eine DNA-Probe dieser Mumien bekommen kann. Nicht wahr, Ms. Malone?«
»Das ist korrekt, Ma’am.« Megan war sich ziemlich sicher, dass das Statistikbüro in Irland nicht wie in Texas Vital Statistics hieß, aber weder sie noch einer der beiden anwesenden Iren erhob Einspruch gegen die Pläne der Frau. »Ich möchte Sie nicht drängen, Mrs. Williams, aber wir sollten uns wirklich auf den Weg machen. Ich wäre nur ungern zu spät, um Ms. Williams abzuholen.«
Mit einem Klimpern ihrer Wimpern warf Cherise Williams dem Priester einen letzten hoffnungsvollen Blick zu, aber in Anbetracht seiner baldigen Rettung blieb er resolut. »Ich hoffe zutiefst, dass man Ihnen im Statistikbüro helfen wird, Mrs. Williams.«
»Oh, davon bin ich überzeugt.« Mrs. Williams rümpfte die Nase und warf sich das kunstvoll ergrauende Haar über die Schulter. »Ich habe gehört, die Iren seien sehr entgegenkommend und niemand könne dem Williams-Charme widerstehen.« Sie fegte aus der Kirche und ließ Megan zurück, die den beiden Männern einen schiefen Blick zuwarf – keiner der beiden hatte sich als besonders entgegenkommend oder empfänglich für Mrs. Williams’ Charme erwiesen. Dann eilte sie ebenfalls aus der Kirche und beeilte sich, den Wagen rechtzeitig zu erreichen und ihrer Kundin die Tür zu öffnen.
»Ich verstehe nicht, warum sie nicht einfach …« Mrs. Williams stieg gestikulierend ins Fahrzeug. »Es hätte ja wohl niemand einen kleinen Finger vermisst.«
»Nun«, sagte Megan so sanft sie konnte und ließ sich auf dem Fahrersitz des Lincoln nieder, »ich schätze, wir müssen bedenken, wie wir uns fühlen würden, würde jemand einfach versuchen, einen Fingerknochen von der Hand unseres Großvaters mitzunehmen.«
»Aber genau darum geht es doch!«, rief Mrs. Williams. »Er ist mein Großvater! Oder zumindest einer von denen ist es. Der letzte Earl war mein Urgroßonkel, also muss sein Vater mein direkter Verwandter gewesen sein.«
»Aber ich meine Ihren richtigen Großvater. Den, der mit Großmutter Elsie verheiratet war.« Megan lenkte den Wagen auf die schwach befahrene Straße. Zu ihrer Rechten lag die Liffey jenseits der Schienen der Luas, des Straßenbahnsystems Dublins. Megan verkniff sich die Bemerkung, dass Mrs. Williams mit der Straßenbahn wahrscheinlich schneller nach Rathmines gelangen würde, wo sie ihren Termin im Statistikbüro hatte.
»Niemand würde den Finger meines Großvaters wollen!«, erwiderte Mrs. Williams schockiert. »Was für eine furchtbare Idee, Ms. Malone. Was in aller Welt haben Sie sich nur dabei gedacht, so etwas zu erwähnen? Wer würde schon den Finger meines Großvaters stehlen?«
»Ich bitte vielmals um Verzeihung, Mrs. Williams«, sagte Megan, ohne eine Miene zu verziehen. Sie fuhr über die Schienen und schlug den Weg entlang der Dublin Quays ein – auch nach drei Jahren hatte sie noch immer Probleme mit diesem Wort, das wie Kies ausgesprochen wurde –, während Cherise Williams weiterhin vor sich her schimpfte, weil Megan, wenn auch nur imaginär, die heilige Unantastbarkeit des Körpers des armen Edgeworth-Großvaters verletzt hatte. Als Cherise schließlich eine Atempause einlegte, nutzte Megan den Augenblick, um ihrer Kundin ein wenig über die Gegend zu erzählen.
»Hier ist die Ha’penny Bridge. Sie war die erste Brücke, die über der Liffey errichtet wurde, und es hat früher einen halben Penny gekostet, wenn man sie passieren wollte – daher auch der Name. Und dort hinten liegt das Trinity College. Ich schätze, es ist gut möglich, dass die Earls von Leitrim dort studiert haben. Und nun fahren wir in das alte georgianische Stadtzentrum. Es kam damals in Mode, als der Duke of Leinster auf die bislang unpopuläre südliche Stadtseite gezogen war …«
»Eine Duchess zu sein …« Mrs. Williams seufzte. »Wäre das nicht wunderbar?«
»Nun, für die meisten von uns wäre es schon unvorstellbar, sich Countess zu nennen.« Megan lächelte der Frau über den Rückspiegel entgegen. Sichtlich besänftigt lauschte Mrs. Williams vergleichsweise ruhig dem Rest von Megans Fremdenführer-Routine.
Einen halben Häuserblock von dem klobig aussehenden Gebäude des Statistikbüros entfernt, wechselte Megan das Thema. »Nun, Mrs. Williams, ich würde gern noch einmal sicherstellen, dass ich Sie richtig verstanden habe. Ich werde Ms. Williams zu Ihrem Hotel bringen und Sie treffen Ihre Tochter dort? Sind Sie sicher, dass ich Sie nicht hier am Büro abholen soll?«
»Ich bin mir sicher, Schätzchen. Fahren Sie und holen Sie Raquel. Wir beide sehen uns morgen früh wieder, wenn wir hinauf nach Leitrum fahren.«
»Leitrim«, wisperte Megan und verzog das Gesicht. Dann fuhr sie auf den Parkplatz des hässlichen Statistikbüros und ließ Mrs. Williams aus dem Wagen. »Falls Sie es sich doch anders überlegen und lieber gefahren werden wollen, haben Sie ja die Nummer meiner Firma. Bitte zögern Sie nicht, dort anzurufen.«
»Danke, Liebes. Oh, und nehmen Sie meinen zweiten Zimmerschlüssel mit, damit Ray-ray direkt ins Hotelzimmer kann.« Trotz Megans Protest reichte Mrs. Williams ihr den Schlüssel und verschwand dann in dem Gebäude. Megan stieß erleichtert den Atem aus und fuhr dann zum Flughafen, wobei sie die herrliche Stille so sehr genoss, dass sie nicht einmal das Radio anmachte.
Raquel Williams’ Flug verspätete sich um beinahe eine ganze Stunde, also klemmte sich Megan das Schild mit Raquels Namen unter den Arm und holte sich einen durchaus passablen Kaffee und ein absolut furchtbares Croissant aus einem der Flughafen-Cafés. Dann setzte sie sich in den Ankunftsbereich, wo sie auf ihre Kundin wartete.
Megan hätte Raquel sofort als Cherise’ Tochter erkannt, selbst wenn diese ihr beim Anblick des Namensschilds nicht zugewinkt hätte. Die junge Frau war größer als ihre Mutter und hatte glänzendes, kastanienbraunes Haar, das nicht ganz zur Farbe ihrer Augenbrauen passte. Ihre Gesichtszüge waren genauso markant wie die ihrer Mutter, doch Raquel trug die Haare deutlich lockerer und moderner als Cherise, deren Frisur Megan immer an einen mit Haarspray fixierten Football-Helm erinnerte. Davon abgesehen war sie das Ebenbild ihrer Mutter – und hatte von Cherise Williams offenbar auch die falsche Aussprache des Wortes Leitrim übernommen.
»Hi, ich bin Raquel Williams, die rechtmäßige Erbin von Leitrum, und ich kann es nicht erwarten, die smaragdgrüne Insel in ihrer ganzen Schönheit kennenzulernen«, begrüßte sie Megan, als sie auf sie zugeeilt kam.
»Megan Malone. Es freut mich, Sie kennenzulernen, Ms. Williams. Ich habe Ihre Mutter schon am …«
»O mein Gott, Sie sind ja auch Amerikanerin! Kommen Sie aus Texas?« Raquel lehnte sich über die Absperrung und zog Megan in eine Umarmung.
Megan versteifte sich überrascht, konnte sich aber ein unbeholfenes Lächeln abringen. »Das tue ich, ja. Aus Austin. Und hier ist Ihr Zimmerschlüssel, den hat mir Ihre Mutter gegeben.«
»Oh, ist das nicht nett von ihr? Und yeah! Austin rockt! Ich wohne inzwischen auch dort, aber meine Mama kommt aus El Paso. Wer hätte je gedacht, dass ein irischer Earl sich in Texas niederlässt, was?« Raquel Williams steckte den Schlüssel in ihre Tasche und trat um die Absperrung herum, wobei sie ihr Gepäck hinter sich herzog. Sie hatte neben ihrer Handtasche eine riesige Handgepäckstasche bei sich und zog einen gewaltigen Koffer, der groß genug war, um drei Viertel eines gesamten Hausrats darin zu verpacken. »Das hat er natürlich auch nicht sofort getan. Er hat eigentlich erst in New York gelebt, aber dann starb sein Sohn im Krieg und er wurde krank. Da hat Gigi Elsie – das ist seine Schwiegertochter und meine Urgroßmutter – ihn nach El Paso gebracht, denn das war der Ort, von dem sie selbst schon immer geträumt hatte. Und sieh einer an, hier sind wir jetzt! Wie geht es Mama?«
Megan lächelte. »Es geht ihr gut. Sie ist gerade im Statistikbüro und hofft, dass sie die Erlaubnis bekommt, eine der Mumien einem DNA-Test zu unterziehen. Ich kann mich gern darum kümmern, wenn Sie möchten, Ma’am.« Sie nickte zu dem riesigen Koffer.
»Oh verdammt, ja klar, aber wenn Sie mich nicht einfach Raquel nennen, fühl ich mich, als wäre ich eine Oma.« Raquel schob den Koffer in Megans Richtung und strahlte. »Ich war bis jetzt noch nie irgendwo außerhalb von Texas, also ist das alles ein riesiges Abenteuer für mich. Wie sind Sie hier gelandet?«
»Ich habe durch meinen Großvater die irische Staatsbürgerschaft bekommen, also können sie mich nicht mehr loswerden.« Megan grinste und bedeutete Raquel, ihr zu folgen, während sie sich auf den Weg zum Parkplatz für Fahrservice-Wagen machte. »Es ist nicht ganz so spannend wie eine Verwandtschaft mit den Earls von Leitrim, aber es hat für mich ganz gut funktioniert.«
»Litrim? O mein Gott, so wird das hier ausgesprochen? Wir haben es die ganze Zeit falsch gesagt! Oh, Mama wird das zum Brüllen finden!«
Raquel plauderte fröhlich vor sich hin und ihr texanischer Akzent kam Megan viel vertrauter und freundlicher vor, als es bei Cherise Williams der Fall war. Sie erreichten den Wagen und auf dem Weg durch Dublin löcherte Raquel Megan mit Fragen über die Gegend und über Leitrims Geschichte, wobei Megan im letzten Punkt keine große Hilfe war. Außerdem wollte Raquel wissen, ob die Iren wirklich so abergläubisch waren, wie man sagte.
»Sie sind nicht direkt abergläubisch«, sagte Megan grinsend. »Aber man muss ja nicht unbedingt eine Straße durch einen Feenring bauen, nicht wahr?«
Gelächter erklang vom Rücksitz. »Okay, verstehe. Hören Sie, ich will echt nicht unhöflich wirken, aber sind wir bald da? Ich wollte am Flughafen eigentlich noch mal für kleine Mädchen, aber dann hab ich es völlig vergessen.«
»Dauert bloß noch ein paar Minuten«, versprach Megan. »Dann können Sie direkt reinlaufen und die Toiletten in der Lobby benutzen, während ich mich um das Gepäck kümmere.«
»Oh, Gott sei Dank«, keuchte Raquel, und als sie das Hotel ein paar Minuten später erreichten, folgte sie Megans Rat und kam im Anschluss zurück vor die Eingangstür. »Zum Glück gibt es öffentliche Toiletten«, sagte sie mit einem leicht betretenen Lächeln. »Wären Sie so nett und könnten mir helfen, die Koffer nach oben zu bringen? Ich würde die dort drinnen nur ungern belästigen.« Sie nickte zur Lobby, in der die Hotelangestellten geschäftig ihren Aufgaben nachgingen.
»Das mach ich doch gern. Sie wohnen übrigens im Zimmer mit der Nummer 403«
Sie fuhren mit dem Aufzug nach oben und Raquel betrat den schmalen Gang mit dem blauen Teppichboden zuerst. »Oh, ist das nicht wunderbar?«, schwärmte sie. »Hier ist alles so atmosphärisch.«
»Ja, so ist vieles hier in Dublin. Es gibt hier unzählige geschichtsträchtige alte Gebäude. Es ist einer der Gründe, weshalb ich die Stadt so liebe.«
»Das kann ich gut nachvollziehen.« Raquel drehte den Schlüssel im Schlüsselloch, drückte die Tür nach innen auf und rammte die Kante dabei geradewegs in die Hüfte ihrer leblosen Mutter.
Kapitel zwei
Raquel schrie so laut, dass ihre Stimme mit voller Wucht von den Betonwänden zurückgeworfen wurde. Sie fiel auf die Knie und umklammerte Cherise Williams’ regungslosen Körper, während Megan hinter ihr ins Schwanken geriet. Die Schreie der jungen Frau hallten in Megans Ohren wider und obwohl Megan ein paar Worte ausmachen konnte – Mama? Mama? Mama, wach auf! Mama, nein! –, waren es hauptsächlich herzzerreißende Klänge der Trauer.
Megans eigener Körper war vor Schock schlagartig abgekühlt, dennoch trat sie über die beiden Williams-Frauen hinweg, kniete sich an Cherise’ freier Seite zu Boden und tastete nach einem Puls. Die Haut der Frau war bereits spürbar erkaltet und Megan konnte weder einen Herzschlag noch einen Atemzug ausmachen. »Es tut mir leid«, wisperte sie und erhob sich, ehe sie das Zimmer durchquerte. Von der anderen Seite aus konnte man vom Fenster auf die O’Connell Street blicken. Vier Stockwerke weiter unten alberten gerade ein paar Teenager herum, und angefangen von Geschäftsleuten in Anzügen bis hin zu Passanten in Jogginghosen gingen alle möglichen Menschen die Durchgangsstraße entlang. Einem Kind war gerade die Eiscreme zu Boden gefallen und es war starr vor Schreck, während sein gestresster Vater hilflos versuchte, sich um die Situation zu kümmern. Dort unten nahm das Leben unbekümmert seinen Lauf, während in Cherise Williams’ Hotelzimmer eine Tragödie stattgefunden hatte. Raquels Schreie hatten inzwischen die Hotelangestellten in das Zimmer gelockt und ihr Gemurmel füllte den kleinen Raum.
Megan zog ihr Handy aus der Innentasche ihrer Chauffeurs-Uniform. Ihre Hände waren so kalt, dass sie mehrere Anläufe brauchte, bis der Berührungssensor des Geräts ihren Finger erkannte. Dann rief sie Detective Paul Bourke an, der bei der An Garda Síochána, der irischen Polizei, arbeitete.
»Megan?«, meldete sich dieser fröhlich am anderen Ende der Leitung. »Was ist bei Ihnen los? Erzählen Sie mir Ihre Geschichte! Sie schreiben mir sonst immer nur, außer wenn Sie eine Leiche gefunden haben.« Als Megan nicht antwortete, verhallte Bourkes selbstzufriedenes Lachen und verwandelte sich in ein besorgtes Schweigen. Als er das Wort erneut ergriff, war jede Spur von Humor aus seiner Stimme gewichen. »Megan?«
»Mir geht es gut.« Megan räusperte sich und versuchte, nicht so zu klingen, als hätte sie einen Frosch verschluckt. »Ich meine … Mir geht es gut. Aber meine Kundin ist tot.«
»Ach du …« Bourke konnte sich sein Fluchen im letzten Moment verkneifen und senkte die Stimme. »Was zur Hölle, Megan?«
»Ich weiß es nicht! Ich weiß es nicht! Ich habe sie vor circa drei Stunden bei Vital Statistics … äh, nein, sorry, ich meine beim Statistikbüro abgesetzt und ihre Tochter vom Flughafen abgeholt. Und als wir gerade ins Hotelzimmer gekommen sind, war sie …« Megan bemerkte, dass die Hotelangestellten sie beobachteten, und zwang sich, leiser zu sprechen. Eine forsche Frau in der Kleidung einer Hotelmanagerin kam auf sie zu und streckte die Hand aus. Offenbar wollte sie, dass Megan ihr das Handy reichte.
»Entschuldigen Sie, Ma’am, aber ich muss Sie bitten, die Einzelheiten der Geschehnisse, die sich in diesem Hotel zugetragen haben, nicht mit …«
»Ich spreche mit der Polizei«, zischte Megan.
Die Frau wurde zunächst blass, dann nahm ihre goldbraune Haut einen immer dunkleren Rotton an. »Ich bin mir sicher, dass das nicht notwendig …«
»Glauben Sie mir«, erwiderte Megan düster, »das ist es absolut.«
Währenddessen drang Detective Bourkes Stimme aus dem Telefon an ihr Ohr. Er sprach abgehackt und klang wie ein Mann, der sich gerade sein Sakko und seinen Mantel überzog, nach seinem Hut suchte und aus der Tür stürzte. Er würde in etwa zehn Minuten im Hotel sein, denn das Polizeirevier in der Pearse Street lag gegenüber dem Hotel auf der anderen Seite der Liffey und an den meisten Tagen war man in Dublins stark befahrener Innenstadt zu Fuß schneller als mit dem Auto.
Die Hotelmanagerin hatte noch immer die Hand ausgestreckt, als würde sie erwarten, dass Megan wie ein bockiges Kind, das des Streits überdrüssig war, nachgeben würde.
Megan drehte sich zum Fenster. Es war ein heller, kalter Nachmittag im Januar und die Eiscreme auf dem Bürgersteig war nicht einmal geschmolzen. Megan suchte die Menge ab und entdeckte den Vater, der seinem Kind geschlagen hinterhereilte, während das Kleine fröhlich über den Gehweg hopste. Allem Anschein nach hatte der Vater versprochen, die gefallene Eiscreme durch eine neue Tüte zu ersetzen. Raquels Schreie waren inzwischen zu einem rauen Schluchzen geworden. Während der Detective mit der Straßenbahn den Fluss überquerte, berichtete Megan, was sie von Cherise Williams’ Reise nach Irland wusste – eine Geschichte, die sie ihm normalerweise bei einem Bier erzählt hätte. Im Hintergrund konnte sie das penetrante Bingbing! der Straßenbahn hören, während die Aufnahme einer Stimme mit irischem RTÉ-Akzent den Fahrgästen Informationen gab, als wäre überhaupt nichts Auffälliges geschehen. Megan hoffte, dass sie leise genug sprach, sodass niemand im Raum sie verstehen konnte – nicht die Hotelmanagerin und schon gar nicht Raquel Williams.
Sie beobachtete, wie Bourke die Luas an der Haltestelle O’Connell Street verließ, die direkt vor dem Hotel lag. Er sah nach rechts und links und sprintete dann über die Straße, wobei er der zu Boden gefallenen Eiscremetüte im letzten Moment ausweichen konnte. Als er das Hotelzimmer der Williams’ erreichte, hielt er sein Handy noch immer an sein Ohr gedrückt und lauschte den letzten Details, die Megan ihm erzählte. Megan überprüfte die Anrufdauer: siebeneinhalb Minuten, er war also schneller gewesen, als sie erwartet hatte. Dann beendete sie den Anruf, während Bourke zuerst Cherise Williams’ Leiche musterte und den Blick dann durch den Raum wandern ließ, bis er auf Megan landete. Dann sah er zu der Toten zurück und schlüpfte nahtlos in die Rolle des professionellen Ermittlers. Er ging neben Raquel in die Knie, hob die Hand und hielt vor ihrer Schulter inne. Obwohl er sie nicht berührte, war es genug, um Raquels Aufmerksamkeit auf sich zu lenken. »Entschuldigen Sie, Ma’am. Mein Name ist Detective Paul Bourke. Können Sie mir erzählen, was hier passiert ist?«
Die Hotelmanagerin trieb ihre Angestellten zusammen und jagte sie aus dem Zimmer, ehe sie versuchte, sich zu dem Detective zu gesellen, ohne Raquel in ihrer Trauer zu belästigen. »Detective, ich bin sehr dankbar, dass Sie so schnell gekommen sind, aber es ist nicht … völlig neu, dass ein Gast auf dem Gelände stirbt. Wir brauchen keine …«
»Aber Mama ging es gut!«, brach es aus Raquel hervor. »Das kann keine natürliche Ursache gehabt haben! Sie hatte ihren Gesundheits-Check-up, kurz bevor sie hierhergekommen ist. Der Doktor sagte, sie sei fit wie ein Turnschuh! Detective, ich möchte, dass eine … dass eine …« Das Feuer verschwand so schnell, wie es gekommen war, und Raquel stiegen erneut die Tränen in die Augen.
Bourke hob den Kopf und sah zu Megan. Sein rotes Haar war zerzaust, sein Blick bestürzt, und alles in allem fand Megan, dass er müde wirkte. Das war allerdings auch nicht erstaunlich, da Megan die unglückliche Angewohnheit entwickelt hatte, über Mordopfer – oder zumindest unerwartete Leichen – zu stolpern, die dadurch unweigerlich auch zu seinem Problem wurden. Zugegeben, es gab in seinem Berufsalltag wohl eher selten so etwas wie erwartete Leichen. Die unerwarteten kamen vermutlich weitaus öfter vor.
»Wir werden alles Nötige unternehmen, um herauszufinden, was mit Ihrer Mutter geschehen ist«, versprach Bourke Raquel. »Meine Forensiker sind bereits auf dem Weg hierher. Möchten Sie mich in der Zwischenzeit hinaus auf den Gang begleiten, Ms. Williams? Ich fürchte, ich muss Ihnen einige Fragen stellen.«
Raquel folgte der Aufforderung und erhob sich, wobei sie neben Bourkes großer, schlanker Statur klein und verunsichert wirkte. Der Detective führte sie nach draußen in den Gang, und die Tür, die durch Raquels Körper aufgehalten worden war, schwang schließlich doch zu. Megan eilte nach vorn und fing sie im letzten Moment ab, vordergründig um sie für Raquel offen zu halten, doch ehrlich gesagt vermutlich eher, damit Megan Bourke und Raquel bei ihrem Gespräch belauschen konnte. Ein junger Mann mit einem stark definierten Kiefer hastete in das Zimmer.
»Doktor«, sagte die Hotelmanagerin erleichtert. Megan musste aus dem Zimmer gehen, um Platz zu machen, denn Cherise Williams’ Leiche saß gegen den Türrahmen des Badezimmers gelehnt, der kaum eine Armlänge von der Eingangstür entfernt war. Inzwischen waren schon sechs Leute über sie hinweggestiegen, Megan eingeschlossen.
Als Megan in den Gang trat und zu Bourke sah, konnte sie ein Leuchten in seinen Augen erkennen. Es ließ sie vermuten, dass er bereits damit gerechnet hatte, dass sie ihm und Raquel folgen würde, auch wenn er sie nicht direkt ansah. Sie nahm eine höfliche Distanz ein, doch Megan musste sich selbst eingestehen, dass höflich in diesem Fall wohl eher bedeutete, dass sie zwar weit genug entfernt stand, um das Gespräch nicht zu stören, aber noch immer nah genug war, um zu lauschen.
Raquel Williams war in Tränen aufgelöst und schüttelte den Kopf. »Natürlich hatte Mama keine Feinde, zumindest solange man Peggy Ann Smithers nicht mitzählt, denn die hat sie immer gehasst.«
»Und wieso hat Ms. Smithers Ihre Mutter gehasst?«
»Nun, sie dachte, sie wäre die Königin des Abschlussballs geworden, hätte Mama ihr nicht den Kerl ausgespannt. Aber Daddy sagt, er habe Peggy Ann nie gedatet und niemand hätte jemals eine Krone auf Peggy Anns wasserstoffblonden Kopf gesetzt, so wie sie Cliff Johnson beim Rodeo nach dem Autounfall behandelt hat …«
Bourke warf Megan einen leicht erstaunten Blick zu, woraufhin sie die Wangen ansaugte und sich auf die Teppichnaht konzentrierte, um ein gequältes Lächeln zu unterdrücken. Sie könnte selbst ein halbes Dutzend solcher Geschichten aus ihrer eigenen High-School-Zeit erzählen, und für einen Fremden hätten sie genauso übertrieben und abgedreht geklungen. Dabei waren diese Dinge in ihren Teenagerjahren das Wichtigste auf der Welt gewesen. Megan vermutete, dass Bourke selbst ähnliche Geschichten aus seiner Jugend hatte, doch in seinen kam vermutlich kein Rodeo vor. Der Detective wandte sich wieder Raquel zu und machte sich ein paar Notizen, als wäre die Erzählung für den Tod ihrer Mutter relevant.
»Aber ich glaube nicht, dass Peggy Ann in den letzten fünfzehn Jahren mit Mama geredet hat, und ich weiß nicht, warum sie nach Irland kommen würde, um ihr etwas anzutun.«
»Das scheint unwahrscheinlich«, stimmte Bourke zu. »Aber ich werde der Sache trotzdem nachgehen. Und natürlich könnte es ebenfalls sein, dass die ganzen Aufregungen auf dieser Reise das Herz Ihrer Mutter in Mitleidenschaft gezogen haben, Ma’am. Durch eine Autopsie werden wir mehr erfahren. Aber es ist schon eine ziemlich wilde Geschichte, die sie hierhergebracht hat. Gibt es Leute, die gewusst haben, dass Ihre Familie annimmt, mit einem irischen Earl verwandt zu sein?«
»O Gott, ich schätze, das haben wir so gut wie jedem erzählt«, sagte Raquel niedergeschlagen. »Hätten Sie das etwa nicht getan? Mama hat sich vielleicht ein bisschen aufgespielt, aber das war alles zu Hause in Texas. Wieso würde ihr jemand bis nach Irland folgen? Und sie war noch nicht lange genug hier, um Bekanntschaften zu machen.«
Megan musste an all die Leute denken, mit denen sich Cherise Williams in den vergangenen beiden Tagen über ihre Verbindung zum Adel unterhalten hatte. Sie presste die Lippen zusammen. Für eine Hauptstadt war Dublin ziemlich überschaubar, und Megan konnte sich gut vorstellen, dass sich die Geschichte von einer Amerikanerin, die in Irland ihr mutmaßliches Recht auf einen britischen Adelstitel einfordern wollte, hier wie ein Lauffeuer verbreitete. Allerdings ließ sie ihre Fantasie im Stich, als sie überlegte, wie diese Tatsache in einem Mord geendet haben könnte. Andererseits hatte sich Cherise bei Leprechaun Limos als Countess Williams vorgestellt. Es war gut denkbar, dass sich so etwas herumsprach.
Der Arzt verließ das Hotelzimmer der Williams’ und Raquel stürzte sofort auf ihn zu und ergriff seine Hand. »Haben Sie etwas herausgefunden? Irgendwas? O Gott, was ist meiner Mommy zugestoßen?«
Bedauern spiegelte sich auf dem Gesicht des jungen Mannes wider. »Ich fürchte, ich kann Ihnen nach einer oberflächlichen Untersuchung noch keine Informationen geben, Ma’am. Es gibt keine offensichtlichen Hinweise für ein Gewaltverbrechen, was normalerweise auf einen Herzinfarkt schließen lässt, aber ich kann Ihnen erst dann mehr Informationen geben, wenn ich Ihre Mutter eingehend untersucht habe. Es tut mir leid. Ich wünschte, ich könnte Ihnen schon jetzt eine Antwort geben.« Er zögerte. »Ich kann Ihnen allerdings anbieten, Ihnen ein Medikament zu verschreiben, mit dem Sie die nächsten Nächte besser schlafen können, wenn Sie das wollen. Ich kann mir vorstellen, dass die kommenden Tage sehr schwierig für Sie werden.«
»O Gott, ja bitte.« Raquel riss das Rezept an sich, das der Arzt ihr entgegenhielt, und Megan fragte sich, ob die Ärzte, die für Hotels auf Abruf bereitstanden, immer einen Rezeptblock bei sich hatten. Dann verabschiedete sich der Arzt, und Bourkes Forensiker erschienen am Hotelzimmer. Megan sah auf ihr Handy und stellte überrascht fest, dass kaum eine halbe Stunde vergangen war, seit sie über Cherise’ Leiche gestolpert waren.
Die leitende Forensikerin, eine kräftige Frau Mitte fünfzig, begann sich mit der Hotelmanagerin darüber zu unterhalten, wer in der Zwischenzeit im Hotelzimmer ein und aus gegangen war. Bestürzt realisierte Megan, dass es inzwischen schon acht Menschen waren, die den potenziellen Tatort verunreinigt hatten: sie selbst, Bourke, Raquel, vier Hotelangestellte und der Arzt. Als die Hotelmanagerin der Forensikerin genau das berichtete, nickte diese grimmig und schickte ihr Team an die Arbeit. Megan fragte sich, ob sie sich vorstellen sollte, denn immerhin war das schon die dritte Leiche, die sie innerhalb von acht Monaten entdeckt hatte, allerdings war sie dabei jedes Mal unterschiedlichen Forensikern begegnet. Bourke war nur deshalb in allen drei Fällen zum leitenden Ermittler geworden, weil Megan ihn inzwischen persönlich kannte, und sie fragte sich, was seine Vorgesetzten über die Amerikanerin zu sagen hatten, die permanent über Leichen stolperte.
Bourke hatte inzwischen so viel wie möglich von Raquel in Erfahrung gebracht, ehe diese vor Trauer erneut in hysterisches Schluchzen ausbrach. Offenbar hatte sie die Tatsache eingeholt, dass sie eine ganze Reihe an fürchterlichen Dingen zu erledigen hatte – unter anderem musste sie ihre Familie zu Hause anrufen und über den Tod ihrer Mutter informieren. Es war eine Situation, in der man in einer Sekunde besonnen Entscheidungen traf und sich in der nächsten vor Schmerz die Haare raufte. Megan trat auf Raquel zu und fragte leise, ob sie für sie zur Apotheke gehen und das Medikament abholen sollte, das der Arzt ihr verschrieben hatte. Die trauernde Frau reichte Megan das Rezept, ohne zu zögern. Bourke bemerkte den Austausch und begleitete Megan zum Aufzug, obwohl sie eigentlich eher die Treppe genommen hätte, wäre es nach ihr gegangen.
»Was denken Sie über die ganze Sache?«, fragte er.
»Ich weiß es wirklich nicht. Raquel irrt sich, was die Anzahl der Menschen angeht, die in diesem Land von der Sache mit dem Erbe wissen, denn Mrs. Williams hat jedem davon erzählt, der sich dafür interessiert hat – und einigen Leuten, die das nicht taten. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, warum sie jemand deswegen umbringen sollte. Wir leben immerhin nicht vor gut hundert Jahren, als Irland gerade erst die Unabhängigkeit erklärt hatte und jeder schlecht auf die Briten zu sprechen war. Ich schätze, dass es noch einige Leute gibt, die eine starke Meinung zu den alten Adelstiteln haben, aber ich glaube nicht, dass diese Menschen im Büro von Leprechaun Limos rumhängen.« Megan atmete tief ein. »Hören Sie, es gibt da noch eine andere Sache, die ich erwähnen sollte. Ich meine, es ist vermutlich kein großes Ding, denn es gibt in der Hotellobby und am Flughafen genug Kameras und mein Wagen hat einen GPS-Tracker, der mir ein Alibi gibt, aber …«
Bourkes sonst pfirsichfarbene Haut nahm einen ungesund blassen Farbton an, der die Sommersprossen auf seinen Wangen betonte. »Aber was?«
Megan seufzte. »Ich hatte einen Schlüssel zu Cherise Williams’ Hotelzimmer.«